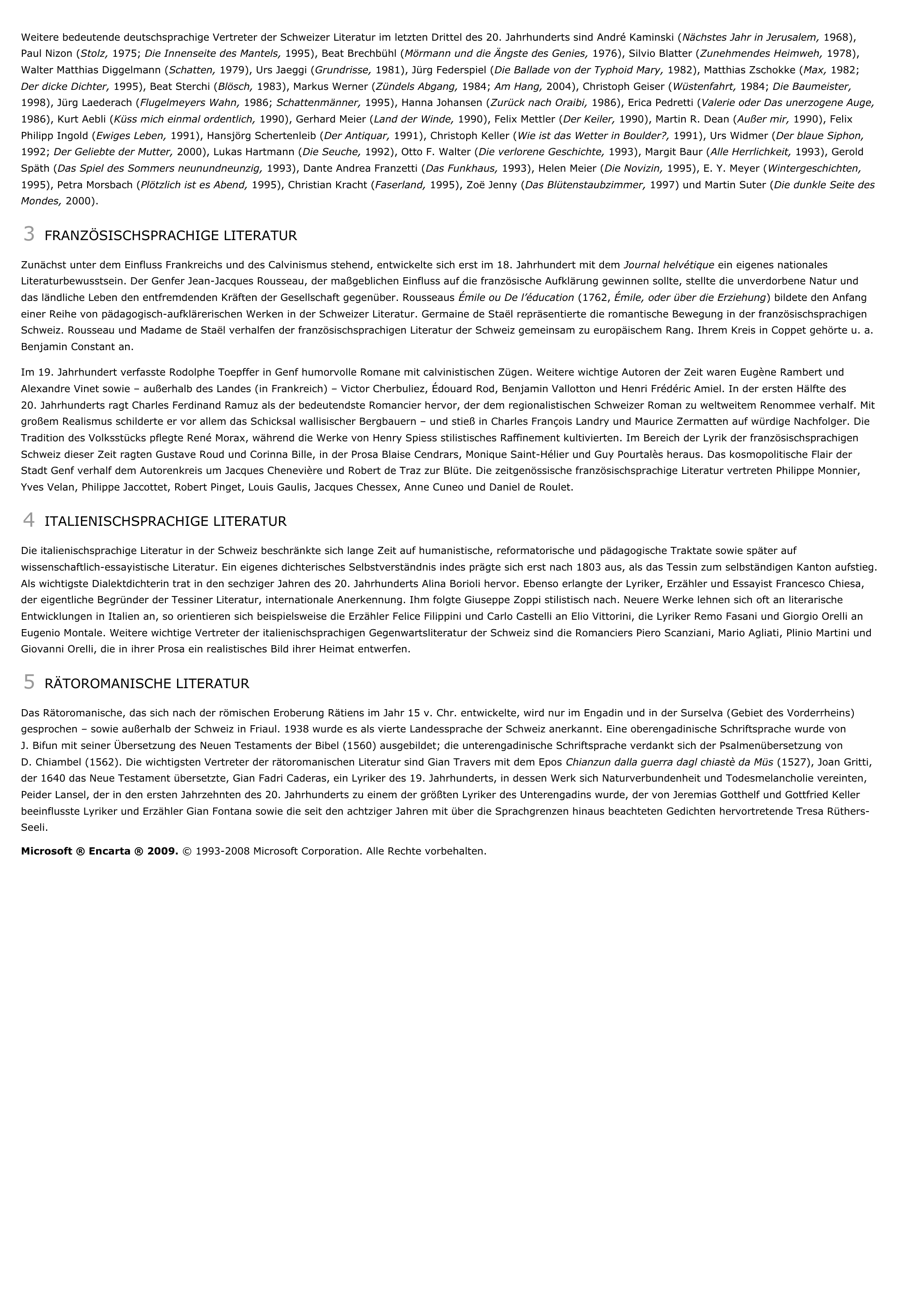Schweizer Literatur (Sprache & Litteratur).
Publié le 12/06/2013
Extrait du document
«
Weitere bedeutende deutschsprachige Vertreter der Schweizer Literatur im letzten Drittel des 20.
Jahrhunderts sind André Kaminski ( Nächstes Jahr in Jerusalem, 1968), Paul Nizon ( Stolz, 1975; Die Innenseite des Mantels, 1995), Beat Brechbühl ( Mörmann und die Ängste des Genies, 1976), Silvio Blatter ( Zunehmendes Heimweh, 1978), Walter Matthias Diggelmann ( Schatten, 1979), Urs Jaeggi ( Grundrisse, 1981), Jürg Federspiel ( Die Ballade von der Typhoid Mary, 1982), Matthias Zschokke ( Max, 1982; Der dicke Dichter, 1995), Beat Sterchi ( Blösch, 1983), Markus Werner ( Zündels Abgang, 1984; Am Hang, 2004), Christoph Geiser ( Wüstenfahrt, 1984; Die Baumeister, 1998), Jürg Laederach ( Flugelmeyers Wahn, 1986; Schattenmänner, 1995), Hanna Johansen ( Zurück nach Oraibi, 1986), Erica Pedretti ( Valerie oder Das unerzogene Auge, 1986), Kurt Aebli ( Küss mich einmal ordentlich, 1990), Gerhard Meier ( Land der Winde, 1990), Felix Mettler ( Der Keiler, 1990), Martin R.
Dean ( Außer mir, 1990), Felix Philipp Ingold ( Ewiges Leben, 1991), Hansjörg Schertenleib ( Der Antiquar, 1991), Christoph Keller ( Wie ist das Wetter in Boulder?, 1991), Urs Widmer ( Der blaue Siphon, 1992; Der Geliebte der Mutter, 2000), Lukas Hartmann ( Die Seuche, 1992), Otto F.
Walter ( Die verlorene Geschichte, 1993), Margit Baur ( Alle Herrlichkeit, 1993), Gerold Späth ( Das Spiel des Sommers neunundneunzig, 1993), Dante Andrea Franzetti ( Das Funkhaus, 1993), Helen Meier ( Die Novizin, 1995), E.
Y.
Meyer ( Wintergeschichten, 1995), Petra Morsbach ( Plötzlich ist es Abend, 1995), Christian Kracht ( Faserland, 1995), Zoë Jenny ( Das Blütenstaubzimmer, 1997) und Martin Suter ( Die dunkle Seite des Mondes, 2000).
3 FRANZÖSISCHSPRACHIGE LITERATUR
Zunächst unter dem Einfluss Frankreichs und des Calvinismus stehend, entwickelte sich erst im 18.
Jahrhundert mit dem Journal helvétique ein eigenes nationales Literaturbewusstsein.
Der Genfer Jean-Jacques Rousseau, der maßgeblichen Einfluss auf die französische Aufklärung gewinnen sollte, stellte die unverdorbene Natur unddas ländliche Leben den entfremdenden Kräften der Gesellschaft gegenüber.
Rousseaus Émile ou De l’éducation (1762, Émile, oder über die Erziehung ) bildete den Anfang einer Reihe von pädagogisch-aufklärerischen Werken in der Schweizer Literatur.
Germaine de Staël repräsentierte die romantische Bewegung in der französischsprachigenSchweiz.
Rousseau und Madame de Staël verhalfen der französischsprachigen Literatur der Schweiz gemeinsam zu europäischem Rang.
Ihrem Kreis in Coppet gehörte u.
a.Benjamin Constant an.
Im 19.
Jahrhundert verfasste Rodolphe Toepffer in Genf humorvolle Romane mit calvinistischen Zügen.
Weitere wichtige Autoren der Zeit waren Eugène Rambert undAlexandre Vinet sowie – außerhalb des Landes (in Frankreich) – Victor Cherbuliez, Édouard Rod, Benjamin Vallotton und Henri Frédéric Amiel.
In der ersten Hälfte des20.
Jahrhunderts ragt Charles Ferdinand Ramuz als der bedeutendste Romancier hervor, der dem regionalistischen Schweizer Roman zu weltweitem Renommee verhalf.
Mitgroßem Realismus schilderte er vor allem das Schicksal wallisischer Bergbauern – und stieß in Charles François Landry und Maurice Zermatten auf würdige Nachfolger.
DieTradition des Volksstücks pflegte René Morax, während die Werke von Henry Spiess stilistisches Raffinement kultivierten.
Im Bereich der Lyrik der französischsprachigenSchweiz dieser Zeit ragten Gustave Roud und Corinna Bille, in der Prosa Blaise Cendrars, Monique Saint-Hélier und Guy Pourtalès heraus.
Das kosmopolitische Flair derStadt Genf verhalf dem Autorenkreis um Jacques Chenevière und Robert de Traz zur Blüte.
Die zeitgenössische französischsprachige Literatur vertreten Philippe Monnier,Yves Velan, Philippe Jaccottet, Robert Pinget, Louis Gaulis, Jacques Chessex, Anne Cuneo und Daniel de Roulet.
4 ITALIENISCHSPRACHIGE LITERATUR
Die italienischsprachige Literatur in der Schweiz beschränkte sich lange Zeit auf humanistische, reformatorische und pädagogische Traktate sowie später aufwissenschaftlich-essayistische Literatur.
Ein eigenes dichterisches Selbstverständnis indes prägte sich erst nach 1803 aus, als das Tessin zum selbständigen Kanton aufstieg.Als wichtigste Dialektdichterin trat in den sechziger Jahren des 20.
Jahrhunderts Alina Borioli hervor.
Ebenso erlangte der Lyriker, Erzähler und Essayist Francesco Chiesa,der eigentliche Begründer der Tessiner Literatur, internationale Anerkennung.
Ihm folgte Giuseppe Zoppi stilistisch nach.
Neuere Werke lehnen sich oft an literarischeEntwicklungen in Italien an, so orientieren sich beispielsweise die Erzähler Felice Filippini und Carlo Castelli an Elio Vittorini, die Lyriker Remo Fasani und Giorgio Orelli anEugenio Montale.
Weitere wichtige Vertreter der italienischsprachigen Gegenwartsliteratur der Schweiz sind die Romanciers Piero Scanziani, Mario Agliati, Plinio Martini undGiovanni Orelli, die in ihrer Prosa ein realistisches Bild ihrer Heimat entwerfen.
5 RÄTOROMANISCHE LITERATUR
Das Rätoromanische, das sich nach der römischen Eroberung Rätiens im Jahr 15 v.
Chr.
entwickelte, wird nur im Engadin und in der Surselva (Gebiet des Vorderrheins)gesprochen – sowie außerhalb der Schweiz in Friaul.
1938 wurde es als vierte Landessprache der Schweiz anerkannt.
Eine oberengadinische Schriftsprache wurde vonJ.
Bifun mit seiner Übersetzung des Neuen Testaments der Bibel (1560) ausgebildet; die unterengadinische Schriftsprache verdankt sich der Psalmenübersetzung vonD.
Chiambel (1562).
Die wichtigsten Vertreter der rätoromanischen Literatur sind Gian Travers mit dem Epos Chianzun dalla guerra dagl chiastè da Müs (1527), Joan Gritti, der 1640 das Neue Testament übersetzte, Gian Fadri Caderas, ein Lyriker des 19.
Jahrhunderts, in dessen Werk sich Naturverbundenheit und Todesmelancholie vereinten,Peider Lansel, der in den ersten Jahrzehnten des 20.
Jahrhunderts zu einem der größten Lyriker des Unterengadins wurde, der von Jeremias Gotthelf und Gottfried Kellerbeeinflusste Lyriker und Erzähler Gian Fontana sowie die seit den achtziger Jahren mit über die Sprachgrenzen hinaus beachteten Gedichten hervortretende Tresa Rüthers-Seeli.
Microsoft ® Encarta ® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation.
Alle Rechte vorbehalten..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Expressionismus (Literatur und Film) (Sprache & Litteratur).
- Millennium: Literatur (Sprache & Litteratur).
- Spanische Literatur (Sprache & Litteratur).
- Französische Literatur (Sprache & Litteratur).
- Italienische Literatur (Sprache & Litteratur).