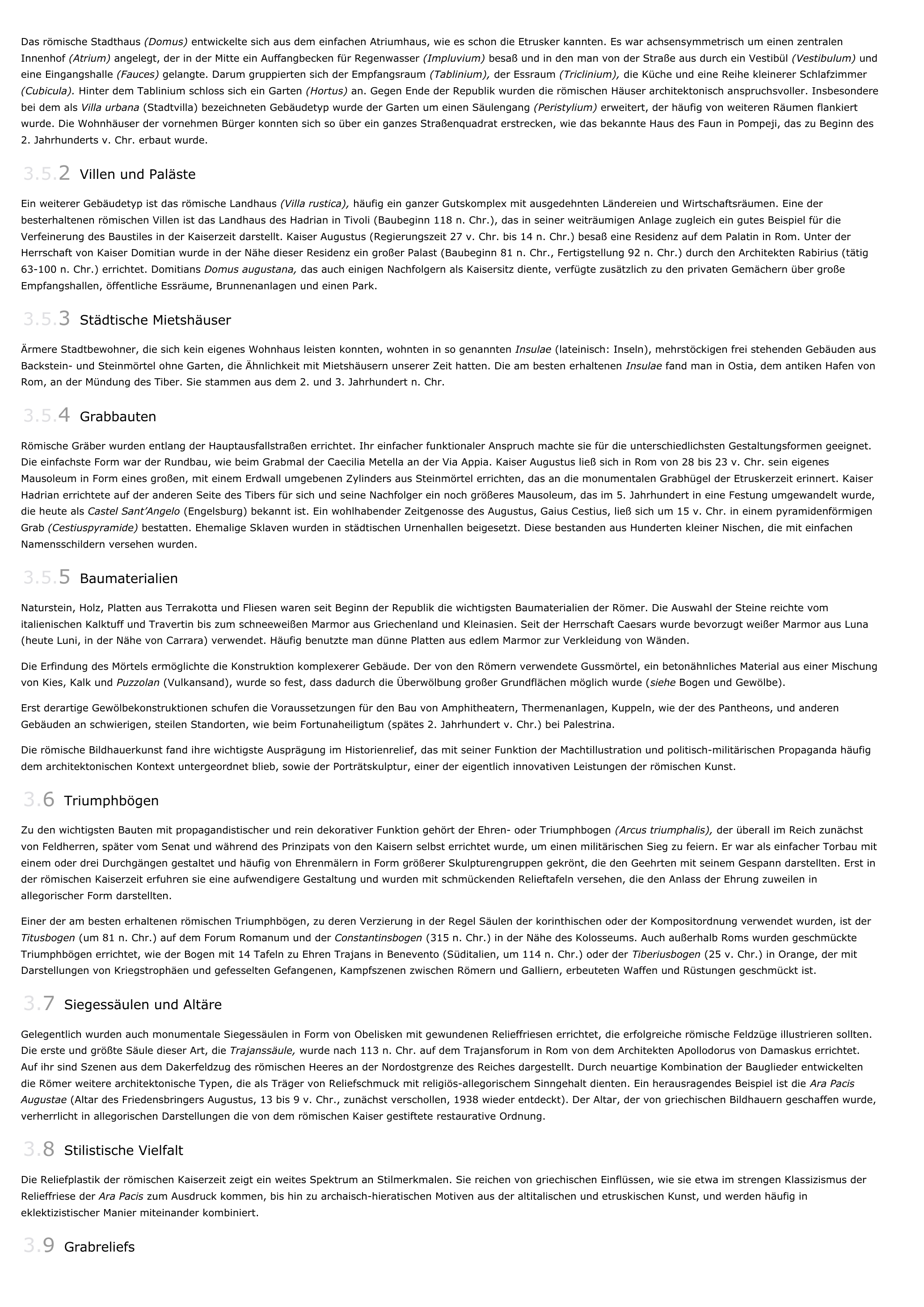Römische Kunst und Architektur - Geschichte.
Publié le 13/06/2013
Extrait du document
«
Das römische Stadthaus (Domus) entwickelte sich aus dem einfachen Atriumhaus, wie es schon die Etrusker kannten.
Es war achsensymmetrisch um einen zentralen Innenhof (Atrium) angelegt, der in der Mitte ein Auffangbecken für Regenwasser (Impluvium) besaß und in den man von der Straße aus durch ein Vestibül (Vestibulum) und eine Eingangshalle (Fauces) gelangte.
Darum gruppierten sich der Empfangsraum (Tablinium), der Essraum (Triclinium), die Küche und eine Reihe kleinerer Schlafzimmer (Cubicula). Hinter dem Tablinium schloss sich ein Garten (Hortus) an.
Gegen Ende der Republik wurden die römischen Häuser architektonisch anspruchsvoller.
Insbesondere bei dem als Villa urbana (Stadtvilla) bezeichneten Gebäudetyp wurde der Garten um einen Säulengang (Peristylium) erweitert, der häufig von weiteren Räumen flankiert wurde.
Die Wohnhäuser der vornehmen Bürger konnten sich so über ein ganzes Straßenquadrat erstrecken, wie das bekannte Haus des Faun in Pompeji, das zu Beginn des2.
Jahrhunderts v.
Chr.
erbaut wurde.
3.5. 2 Villen und Paläste
Ein weiterer Gebäudetyp ist das römische Landhaus (Villa rustica), häufig ein ganzer Gutskomplex mit ausgedehnten Ländereien und Wirtschaftsräumen.
Eine der besterhaltenen römischen Villen ist das Landhaus des Hadrian in Tivoli (Baubeginn 118 n.
Chr.), das in seiner weiträumigen Anlage zugleich ein gutes Beispiel für dieVerfeinerung des Baustiles in der Kaiserzeit darstellt.
Kaiser Augustus (Regierungszeit 27 v.
Chr.
bis 14 n.
Chr.) besaß eine Residenz auf dem Palatin in Rom.
Unter derHerrschaft von Kaiser Domitian wurde in der Nähe dieser Residenz ein großer Palast (Baubeginn 81 n.
Chr., Fertigstellung 92 n.
Chr.) durch den Architekten Rabirius (tätig63-100 n.
Chr.) errichtet.
Domitians Domus augustana, das auch einigen Nachfolgern als Kaisersitz diente, verfügte zusätzlich zu den privaten Gemächern über große Empfangshallen, öffentliche Essräume, Brunnenanlagen und einen Park.
3.5. 3 Städtische Mietshäuser
Ärmere Stadtbewohner, die sich kein eigenes Wohnhaus leisten konnten, wohnten in so genannten Insulae (lateinisch: Inseln), mehrstöckigen frei stehenden Gebäuden aus Backstein- und Steinmörtel ohne Garten, die Ähnlichkeit mit Mietshäusern unserer Zeit hatten.
Die am besten erhaltenen Insulae fand man in Ostia, dem antiken Hafen von Rom, an der Mündung des Tiber.
Sie stammen aus dem 2.
und 3.
Jahrhundert n.
Chr.
3.5. 4 Grabbauten
Römische Gräber wurden entlang der Hauptausfallstraßen errichtet.
Ihr einfacher funktionaler Anspruch machte sie für die unterschiedlichsten Gestaltungsformen geeignet.Die einfachste Form war der Rundbau, wie beim Grabmal der Caecilia Metella an der Via Appia.
Kaiser Augustus ließ sich in Rom von 28 bis 23 v.
Chr.
sein eigenesMausoleum in Form eines großen, mit einem Erdwall umgebenen Zylinders aus Steinmörtel errichten, das an die monumentalen Grabhügel der Etruskerzeit erinnert.
KaiserHadrian errichtete auf der anderen Seite des Tibers für sich und seine Nachfolger ein noch größeres Mausoleum, das im 5.
Jahrhundert in eine Festung umgewandelt wurde,die heute als Castel Sant’Angelo (Engelsburg) bekannt ist.
Ein wohlhabender Zeitgenosse des Augustus, Gaius Cestius, ließ sich um 15 v.
Chr.
in einem pyramidenförmigen Grab (Cestiuspyramide) bestatten.
Ehemalige Sklaven wurden in städtischen Urnenhallen beigesetzt.
Diese bestanden aus Hunderten kleiner Nischen, die mit einfachen Namensschildern versehen wurden.
3.5. 5 Baumaterialien
Naturstein, Holz, Platten aus Terrakotta und Fliesen waren seit Beginn der Republik die wichtigsten Baumaterialien der Römer.
Die Auswahl der Steine reichte vomitalienischen Kalktuff und Travertin bis zum schneeweißen Marmor aus Griechenland und Kleinasien.
Seit der Herrschaft Caesars wurde bevorzugt weißer Marmor aus Luna(heute Luni, in der Nähe von Carrara) verwendet.
Häufig benutzte man dünne Platten aus edlem Marmor zur Verkleidung von Wänden.
Die Erfindung des Mörtels ermöglichte die Konstruktion komplexerer Gebäude.
Der von den Römern verwendete Gussmörtel, ein betonähnliches Material aus einer Mischungvon Kies, Kalk und Puzzolan (Vulkansand), wurde so fest, dass dadurch die Überwölbung großer Grundflächen möglich wurde ( siehe Bogen und Gewölbe).
Erst derartige Gewölbekonstruktionen schufen die Voraussetzungen für den Bau von Amphitheatern, Thermenanlagen, Kuppeln, wie der des Pantheons, und anderenGebäuden an schwierigen, steilen Standorten, wie beim Fortunaheiligtum (spätes 2.
Jahrhundert v.
Chr.) bei Palestrina.
Die römische Bildhauerkunst fand ihre wichtigste Ausprägung im Historienrelief, das mit seiner Funktion der Machtillustration und politisch-militärischen Propaganda häufigdem architektonischen Kontext untergeordnet blieb, sowie der Porträtskulptur, einer der eigentlich innovativen Leistungen der römischen Kunst.
3.6 Triumphbögen
Zu den wichtigsten Bauten mit propagandistischer und rein dekorativer Funktion gehört der Ehren- oder Triumphbogen (Arcus triumphalis), der überall im Reich zunächst von Feldherren, später vom Senat und während des Prinzipats von den Kaisern selbst errichtet wurde, um einen militärischen Sieg zu feiern.
Er war als einfacher Torbau miteinem oder drei Durchgängen gestaltet und häufig von Ehrenmälern in Form größerer Skulpturengruppen gekrönt, die den Geehrten mit seinem Gespann darstellten.
Erst inder römischen Kaiserzeit erfuhren sie eine aufwendigere Gestaltung und wurden mit schmückenden Relieftafeln versehen, die den Anlass der Ehrung zuweilen inallegorischer Form darstellten.
Einer der am besten erhaltenen römischen Triumphbögen, zu deren Verzierung in der Regel Säulen der korinthischen oder der Kompositordnung verwendet wurden, ist derTitusbogen (um 81 n.
Chr.) auf dem Forum Romanum und der Constantinsbogen (315 n.
Chr.) in der Nähe des Kolosseums.
Auch außerhalb Roms wurden geschmückte Triumphbögen errichtet, wie der Bogen mit 14 Tafeln zu Ehren Trajans in Benevento (Süditalien, um 114 n.
Chr.) oder der Tiberiusbogen (25 v.
Chr.) in Orange, der mit Darstellungen von Kriegstrophäen und gefesselten Gefangenen, Kampfszenen zwischen Römern und Galliern, erbeuteten Waffen und Rüstungen geschmückt ist.
3.7 Siegessäulen und Altäre
Gelegentlich wurden auch monumentale Siegessäulen in Form von Obelisken mit gewundenen Relieffriesen errichtet, die erfolgreiche römische Feldzüge illustrieren sollten.Die erste und größte Säule dieser Art, die Trajanssäule, wurde nach 113 n.
Chr.
auf dem Trajansforum in Rom von dem Architekten Apollodorus von Damaskus errichtet. Auf ihr sind Szenen aus dem Dakerfeldzug des römischen Heeres an der Nordostgrenze des Reiches dargestellt.
Durch neuartige Kombination der Bauglieder entwickeltendie Römer weitere architektonische Typen, die als Träger von Reliefschmuck mit religiös-allegorischem Sinngehalt dienten.
Ein herausragendes Beispiel ist die Ara Pacis Augustae (Altar des Friedensbringers Augustus, 13 bis 9 v.
Chr., zunächst verschollen, 1938 wieder entdeckt).
Der Altar, der von griechischen Bildhauern geschaffen wurde, verherrlicht in allegorischen Darstellungen die von dem römischen Kaiser gestiftete restaurative Ordnung.
3.8 Stilistische Vielfalt
Die Reliefplastik der römischen Kaiserzeit zeigt ein weites Spektrum an Stilmerkmalen.
Sie reichen von griechischen Einflüssen, wie sie etwa im strengen Klassizismus derRelieffriese der Ara Pacis zum Ausdruck kommen, bis hin zu archaisch-hieratischen Motiven aus der altitalischen und etruskischen Kunst, und werden häufig in eklektizistischer Manier miteinander kombiniert.
3.9 Grabreliefs.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Griechische Kunst und Architektur - Geschichte.
- Romanische Kunst und Architektur.
- Renaissance: Werke aus Kunst und Architektur.
- Moderne Kunst und Architektur.
- Expressionismus (Kunst und Architektur).