Kierkegaard
Publié le 22/02/2012
Extrait du document
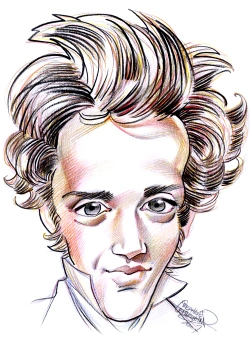
Auf den letzten Seiten des Begriffs der Ironie hat Kierkegaard angedeutet,
daß es die »Aufgabe der Zeit« sei, »die Resultate der Wissenschaft
« - gemeint ist die Hegelsche - »in das persönliche Leben zu
übersetzen«, sie sich persönlich »anzueignen«. Denn es wäre doch lächerlich,
wenn jemand sein Leben lang lehrte, die »Wirklichkeit« habe
absolute Bedeutung und stürbe, ohne daß sie eine andere Gültigkeit
hatte als die, daß er diese Weisheit verkündet hätte. Als ein Weg zur
Bewährung der Wirklichkeit sei die Negativität der Ironie zu gebrauchen,
welche die »Wirklichkeit wirklich zu machen« lehrt, indem
sie auf sie den gebührenden Nachdruck legt.444 Als Kierkegaard nach
Abschluß seiner Dissertation die Reise nach Berlin unternahm, um
Schelling zu hören, erwartete er sich von dessen positiver Philosophie
einen Aufschluß über die Wirklichkeit, den er bei Hegel nicht fand.
Eine Tagebuchnotiz lautet: »Ich bin so froh, Schellings zweite Vorlesung
gehört zu haben — unbeschreiblich. So habe ich ja lange genug
geseufzt und die Gedanken geseufzt in mir; da er das Wort, >Wirklichkeit<
nannte über das Verhältnis der Philosophie zur Wirklichkeit,
da hüpfte die Gedankenfrucht in mir vor Freude wie in Elisabeth. Ich
erinnere fast jedes Wort, das er von diesem Augenblick an sagte. Hier
kann vielleicht Klarheit kommen. Dieses eine Wort, das mich an alle
meine philosophischen Leiden und Qualen erinnerte.«445 Dieser Erwartung
folgte alsbald die Enttäuschung: »Meine Zeit erlaubt mir
nicht, tropfenweise einzunehmen, was auf einmal zu verschlucken ich
kaum den Mund auftun würde. Ich bin zu alt, um Vorlesungen zu hören,
gleichwie Schelling zu alt ist, um sie zu halten. Seine ganze Lehre
von Potenzen verrät die höchste Impotenz.«446 Ein Nachklang der
Enttäuschung an Hegel und Schelling ist das Epigramm aus Entweder-
Oder: »Wenn man die Philosophen von der Wirklichkeit reden hört,
so ist das oft ebenso irreführend, wie wenn man im Schaufenster eines
Trödlers auf einem Schild die Worte liest: Hier wird gerollt. Wollte
man mit seiner Wäsche kommen, um sie rollen zu lassen, so wäre man
angeführt. Der Schild hängt nur zum Verkauf da.«447 Von da ab zieht
sich durch Kierkegaards Schriften eine mehr oder minder explizite Polemik
gegen den Anspruch der Philosophie, die Wirklichkeit durch
Vernunft zu begreifen.
166
Den Grund für Hegels Versagen gegenüber der Wirklichkeit sieht
Kierkegaard nicht wie Marx in einer mangelhaften Konsequenz des
Prinzips, sondern darin, daß Hegel überhaupt das Wesen mit der Existenz
ineinssetzen will. Gerade deswegen bringt er es niemals zur Darstellung
einer »wirklichen« Existenz, sondern immer nur bis zu einer
idealen »Begriffsexistenz«. Denn die essentia von etwas, oder was etwas
ist, betrifft das allgemeine Wesen; die existentia, oder daß etwas ist, das
jeweils einzelne Dasein, meine und deine je eigene Existenz, für die es
etwas Entscheidendes ist, ob sie ist oder nicht ist.448 Kierkegaards Hegelkritik
geht wieder auf Kants Kritik des ontologischen Gottesbeweises
zurück, um dessen Unterscheidung der Essenz von der Existenz
als das »einzig redliche Denken an Existenz« zu rechtfertigen.449
Daß die Existenz das Denken vom Sein »spatiiert«, hat Hegel jedoch
nicht begreifen können, weil er nicht als Mensch, sondern in der Differenz
eines besonderen Talents, als Berufsdenker, dachte. Was er vom
Sein begriff, war nur sein Begriff, aber nicht seine Wirklichkeit, die
eine jeweils einzelne ist.450 Die Kategorie der Einzelheit ist aber nicht
eine Kategorie unter andern, sondern die ausgezeichnete Bestimmung
der Wirklichkeit überhaupt; denn wirklich existierend ist schon nach
Aristoteles immer nur »dieses bestimmte Etwas«, das Einzelne, welches
hier und jetzt da ist.451 In Hegels Lehre vom Begriff ist die Einzelheit
zwar auch als das einzig Wirkliche postuliert, aber in der gleichgültigen
Vermittlung mit dem Besonderen und Allgemeinen.452 Die
einzelne Wirklichkeit bedeutet ihm die in sich reflektierte, besondere
Bestimmtheit des Allgemeinen, der einzelne Mensch also eine besondere
Bestimmtheit des allgemeinen Menschseins, dessen Wesen der Geist ist.
Diese Allgemeinheit des Menschseins, das Allgemein-Menschliche, hat
Kierkegaard zwar nicht verneint, aber nur vom Einzelnen aus für
realisierbar gehalten, wogegen ihm das Allgemeine des Geistes (Hegel)
oder der Menschheit (Marx) existenziell wesenlos schien.
Kierkegaards Polemik gegen Hegels Begriff von der Wirklichkeit variiert
im Grunde immer nur den einen, zentralen Gedanken, daß ein
»System« des Daseins die Wirklichkeit überhaupt nicht aufnehmen
kann, und daß ein »Paragraph«, der von der Wirklichkeit innerhalb
des Systems handelt, ein absoluter Protest gegen es ist.453 Ȇberschreibt
man so den letzten Abschnitt der Logik >die Wirklichkeit<, so gewinnt
man damit den Vorteil, daß man den Schein erregt, als sei man in der
Logik schon zu dem Höchsten, oder wenn man so will, zu dem Niedrigsten
gekommen. Indessen fällt der Nachteil in die Augen: es ist
weder der Logik noch der Wirklichkeit damit gedient. Nicht der
167
Wirklichkeit: denn die Zufälligkeit, welche zur Wirklichkeit wesentlich
mitgehört, kann die Logik nicht passieren lassen. Der Logik nicht:
denn wenn sie die Wirklichkeit gedacht hat, so hat sie etwas in sich
aufgenommen, das sie sich nicht assimilieren kann; sie hat vorweggenommen,
was sie bloß prädisponieren soll. Als Strafe stellt sich
deutlich ein, daß jede Untersuchung, was Wirklichkeit sei, erschwert,
ja vielleicht zunächst unmöglich gemacht ist, weil dem Wort zuerst
Zeit gelassen werden muß, sich gleichsam auf sich selbst zu besinnen,
Zeit, den Fehler zu vergessen.« 454
Das eigentliche »Zufällige« oder auch »Wunderbare«,455 das Hegel
aus dem Begriff der wahren Wirklichkeit ausschließt, besteht aber
darin, daß überhaupt etwas ist und daß ich überhaupt da bin.456 Gerade
dies bloße Daß-Sein macht das absolute »Interesse« an der Wirklichkeit
aus, wogegen die Hegelsche Abstraktion verlangt, daß man
daran in der Tat interesselos ist.437 Am Interesse der Metaphysik
strandet die Immanenz des Systems,458 innerhalb dessen das Sein und
das Nichts gleichgültige Möglichkeiten des reinen und bloßen Denkens
sind. Für den selbst Existierenden ist aber die Existenz als solche von
höchstem Interesse und »die Interessiertheit am Existieren die Wirklichkeit
«. »Was Wirklichkeit ist, läßt sich in der Sprache der Abstraktion
nicht ausdrücken. Die Wirklichkeit ist ein inter-esse zwischen der
hypothetischen Abstraktionseinheit von Denken und Sein.«459
Mit dieser Erhebung des factum brutum der Existenz zur maßgebenden
Wirklichkeit überhaupt verlegt sich bei Kierkegaard das universale
Problem des Seins in die Frage nach dem menschlichen Dasein, und
als dessen eigentliches Problem gilt nicht, was es ist, sondern, daß es
überhaupt da ist. Desgleichen fragt die von Kierkegaard herkünftige
Existenzphilosophie nicht mehr nach der essentia im Unterschied zur
existentia, sondern die Existenz als solche scheint ihr das einzig Wesentliche
zu sein.
Die Begründung der Wirklichkeit im »Interesse« ist Kierkegaard mit
Feuerbach, Ruge und Marx gemein, wennschon die Art des Interesses
bei Feuerbach sinnlich, bei Ruge ethisch-politisch und bei Marx praktisch-
sozial bestimmt ist. Kierkegaard bezeichnet das Interesse als
»Leidenschaft« oder »Pathos« und setzt es der spekulativen Vernunft
entgegen.460 Das Wesen der Leidenschaft ist, daß sie im Unterschied
zum abschließenden »Schluß« von Hegels System zu einem Entschluß
treibt,461 der »entweder« so »oder« anders entscheidet. Eine Entscheidung
im ausgezeichneten Sinn ist der Sprung, dieser »entschiedene
Protest gegen den inversen Gang der Methode«, nämlich der dialek-
168
tischen Reflexion.462 Die entschlossene Leidenschaft der zum Sprung
bereiten Entscheidung setzt einen unvermittelten Anfang, wogegen
der Anfang der Hegelschen Logik in Wahrheit nicht mit dem »Unmittelbaren
« beginnt, sondern mit dem Produkt einer äußersten Reflexion:
dem reinen Sein überhaupt, unter Abstraktion vom wirklich
existierenden Dasein.463 Mit diesen Existenzbestimmungen reduziert
Kierkegaard das sich wissende Reich der vernünftigen Wirklichkeit
auf die »einzige Wirklichkeit, von der ein Existierender nicht nur
weiß«, nämlich auf die: »daß er da ist.«464 Dem welthistorischen
Denken mag das als »Akosmismus« erscheinen, es ist aber dennoch der
einzige Weg, um das enzyklopädisch zerstreute Wissen der Zeit auf
seinen Ursprung zurückzuführen und wieder einen primären Eindruck
von der Existenz zu bekommen.485 Wollte man aber daraus schließen,
daß der Existierende überhaupt nicht denkt und das Wissen »lazzaronihaft
« angreift, so wäre das ein Mißverständnis. Er denkt nur umgekehrt
alles in bezug auf sich selbst, aus Interesse am sich selbst verstehenden
Daseins, welches zwar teilhat an der Idee, aber nicht selbst
als Idee ist.466 In Griechenland war die Aufgabe, die Abstraktion des
Seins zu erreichen, jetzt liegt die Schwierigkeit umgekehrt darin, auf
der Höhe der Hegelschen Abstraktion wieder die Existenz zu gewinnen.
Sich selbst in Existenz zu verstehen war schon das griechische
Prinzip und noch mehr das christliche, aber seit dem Sieg des
»Systems« liebt, glaubt und handelt man nicht mehr selbst, man will
nur wissen, was all dies ist.
Kierkegaards polemischer Begriff von der wirklichen Existenz ist nicht
nur gegen Hegel gerichtet, sondern zugleich ein Korrektiv gegen die
Forderungen der Zeit. Die auf sich selbst vereinzelte Existenz ist 1. die
ausgezeichnete und einzige Wirklichkeit gegenüber dem System, das
alles in gleicher Weise umgreift und den Unterschied (zwischen dem
Sein und dem Nichts, dem Denken und Sein, der Allgemeinheit und
Einzelheit) einebnet auf die Ebene eines gleichgültigen Seins. Sie ist
2. des Einzelnen Wirklichkeit gegenüber der geschichtlichen Allgemeinheit
(der Weltgeschichte und Generation, der Menge, des Publikums
und der Zeit), der das Individuum als solches nichts gilt. Sie ist
3. die innerliche Existenz des Einzelnen gegenüber der Äußerlichkeit
der Verhältnisse. Sie ist 4. eine christliche Existenz vor Gott gegenüber
der Veräußerlichung des Christseins in der weltgeschichtlich verbreiteten
Christenheit. Und sie ist 5. inmitten dieser Bestimmungen
vor allem eine sich selbst entscheidende Existenz, entweder für oder
gegen das Christsein. Als eine sich so oder so entscheidende Existenz
169
ist sie der Gegensatz zur »verständigen« Zeit und zu Hegels Begreifen,
die ein Entweder-Oder nicht kennen.467
Kurz vor der Revolution von 1848 haben Marx und Kierkegaard
dem Willen zu einer Entscheidung eine Sprache verliehen, deren
Worte auch jetzt noch ihren Anspruch erheben: Marx im Kommunistischen
Manifest (1847) und Kierkegaard in einer »Literarischen Anmeldung
« (1846). Das eine Manifest schließt: »Proletarier aller Länder
vereinigt euch« und das andere damit, daß jeder für sich an seiner
eigenen Rettung arbeiten solle, dagegen sei die Prophetie über den
Fortgang der Welt höchstens als Scherz erträglich. Dieser Gegensatz
bedeutet aber geschichtlich betrachtet nur zwei Seiten einer gemeinsamen
Destruktion der bürgerlich-christlichen Welt. Zur Revolution
der bürgerlidi-kapitalistiscben Welt hat sich Marx auf die Masse des
Proletariats gestützt, während Kierkegaard in seinem Kampf gegen
die bürgerlidi-christliche Welt alles auf den Einzelnen setzt. Dem entspricht,
daß für Marx die bürgerliche Gesellschaft eine Gesellschaft von
»vereinzelten Einzelnen« ist, in welcher der Mensch seinem »Gattungswesen
« entfremdet ist, und für Kierkegaard die Christenheit ein massenhaft
verbreitetes Christentum, in dem niemand ein Nachfolger
Christi ist. Weil aber Hegel diese existierenden Widersprüche im Wesen
vermittelt hat: die bürgerliche Gesellschaft mit dem Staat und den
Staat mit dem Christentum, zielt die Entscheidung von Marx wie von
Kierkegaard auf die Hervorhebung des Unterschieds und des Widerspruchs
in eben jenen Vermittlungen. Marx richtet sich auf die Selbstentfremdung,
die für den Menschen der Kapitalismus ist, und Kierkegaard
auf diejenige, die für den Christen die Christenheit ist.
Liens utiles
- La vie n'est pas un problème à résoudre, mais une réalité dont il faut faire l'expérience. Kierkegaard
- Kierkegaard et Bouddhisme
- TRAITÉ DU DÉSESPOIR ou LA MALADIE MORTELLE, Soren Aabye Kierkegaard (résumé & analyse)
- CRAINTE ET TREMBLEMENT, Lyrique-Dialectique, Kierkegaard (résumé et analyse)
- JOHANNES le séducteur [Johannes Forföreren] de Sôren Kierkegaard































