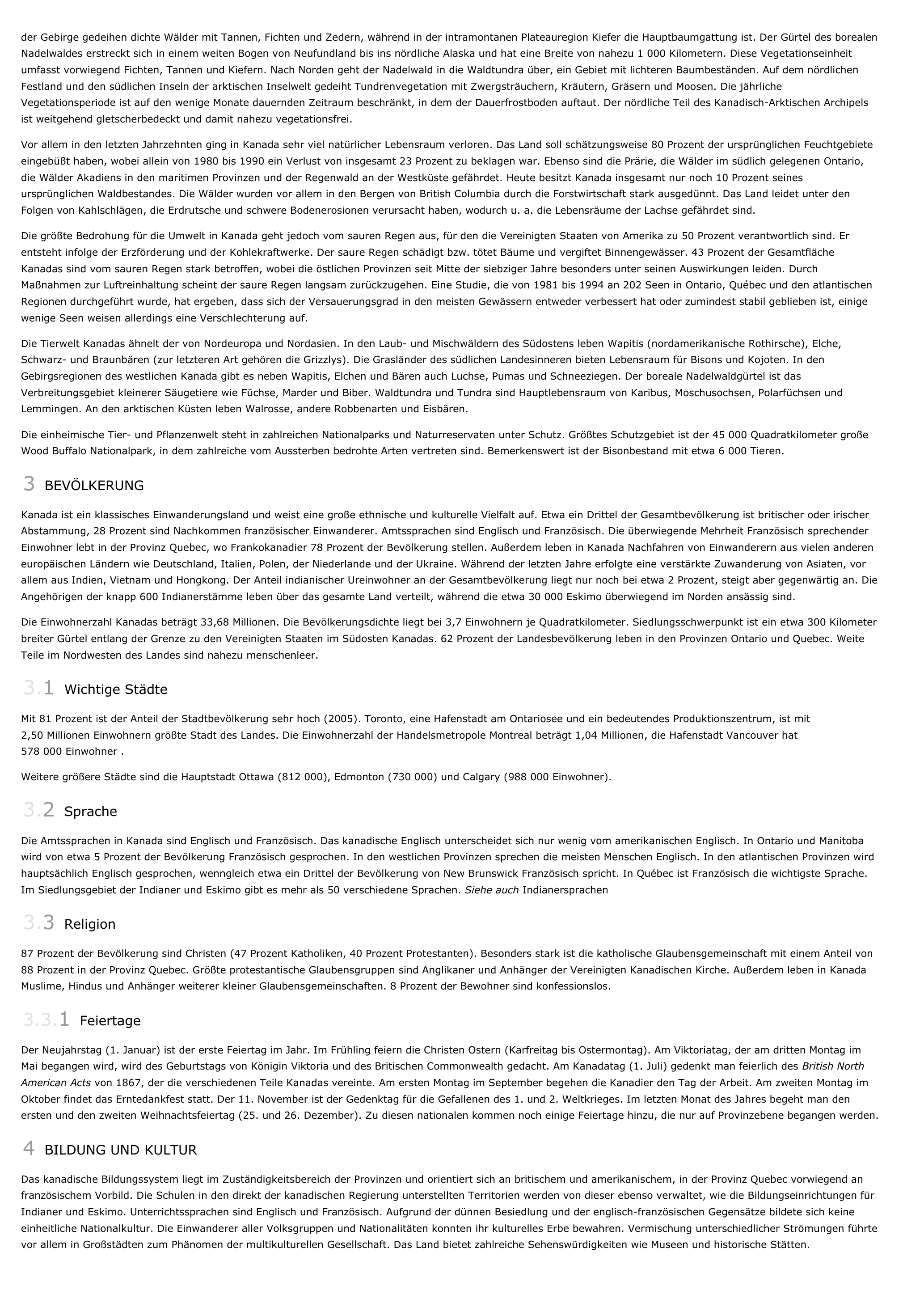Kanada - geographie.
Publié le 06/06/2013
Extrait du document
«
der Gebirge gedeihen dichte Wälder mit Tannen, Fichten und Zedern, während in der intramontanen Plateauregion Kiefer die Hauptbaumgattung ist.
Der Gürtel des borealenNadelwaldes erstreckt sich in einem weiten Bogen von Neufundland bis ins nördliche Alaska und hat eine Breite von nahezu 1 000 Kilometern.
Diese Vegetationseinheitumfasst vorwiegend Fichten, Tannen und Kiefern.
Nach Norden geht der Nadelwald in die Waldtundra über, ein Gebiet mit lichteren Baumbeständen.
Auf dem nördlichenFestland und den südlichen Inseln der arktischen Inselwelt gedeiht Tundrenvegetation mit Zwergsträuchern, Kräutern, Gräsern und Moosen.
Die jährlicheVegetationsperiode ist auf den wenige Monate dauernden Zeitraum beschränkt, in dem der Dauerfrostboden auftaut.
Der nördliche Teil des Kanadisch-Arktischen Archipelsist weitgehend gletscherbedeckt und damit nahezu vegetationsfrei.
Vor allem in den letzten Jahrzehnten ging in Kanada sehr viel natürlicher Lebensraum verloren.
Das Land soll schätzungsweise 80 Prozent der ursprünglichen Feuchtgebieteeingebüßt haben, wobei allein von 1980 bis 1990 ein Verlust von insgesamt 23 Prozent zu beklagen war.
Ebenso sind die Prärie, die Wälder im südlich gelegenen Ontario,die Wälder Akadiens in den maritimen Provinzen und der Regenwald an der Westküste gefährdet.
Heute besitzt Kanada insgesamt nur noch 10 Prozent seinesursprünglichen Waldbestandes.
Die Wälder wurden vor allem in den Bergen von British Columbia durch die Forstwirtschaft stark ausgedünnt.
Das Land leidet unter denFolgen von Kahlschlägen, die Erdrutsche und schwere Bodenerosionen verursacht haben, wodurch u.
a.
die Lebensräume der Lachse gefährdet sind.
Die größte Bedrohung für die Umwelt in Kanada geht jedoch vom sauren Regen aus, für den die Vereinigten Staaten von Amerika zu 50 Prozent verantwortlich sind.
Erentsteht infolge der Erzförderung und der Kohlekraftwerke.
Der saure Regen schädigt bzw.
tötet Bäume und vergiftet Binnengewässer.
43 Prozent der GesamtflächeKanadas sind vom sauren Regen stark betroffen, wobei die östlichen Provinzen seit Mitte der siebziger Jahre besonders unter seinen Auswirkungen leiden.
DurchMaßnahmen zur Luftreinhaltung scheint der saure Regen langsam zurückzugehen.
Eine Studie, die von 1981 bis 1994 an 202 Seen in Ontario, Québec und den atlantischenRegionen durchgeführt wurde, hat ergeben, dass sich der Versauerungsgrad in den meisten Gewässern entweder verbessert hat oder zumindest stabil geblieben ist, einigewenige Seen weisen allerdings eine Verschlechterung auf.
Die Tierwelt Kanadas ähnelt der von Nordeuropa und Nordasien.
In den Laub- und Mischwäldern des Südostens leben Wapitis (nordamerikanische Rothirsche), Elche,Schwarz- und Braunbären (zur letzteren Art gehören die Grizzlys).
Die Grasländer des südlichen Landesinneren bieten Lebensraum für Bisons und Kojoten.
In denGebirgsregionen des westlichen Kanada gibt es neben Wapitis, Elchen und Bären auch Luchse, Pumas und Schneeziegen.
Der boreale Nadelwaldgürtel ist dasVerbreitungsgebiet kleinerer Säugetiere wie Füchse, Marder und Biber.
Waldtundra und Tundra sind Hauptlebensraum von Karibus, Moschusochsen, Polarfüchsen undLemmingen.
An den arktischen Küsten leben Walrosse, andere Robbenarten und Eisbären.
Die einheimische Tier- und Pflanzenwelt steht in zahlreichen Nationalparks und Naturreservaten unter Schutz.
Größtes Schutzgebiet ist der 45 000 Quadratkilometer großeWood Buffalo Nationalpark, in dem zahlreiche vom Aussterben bedrohte Arten vertreten sind.
Bemerkenswert ist der Bisonbestand mit etwa 6 000 Tieren.
3 BEVÖLKERUNG
Kanada ist ein klassisches Einwanderungsland und weist eine große ethnische und kulturelle Vielfalt auf.
Etwa ein Drittel der Gesamtbevölkerung ist britischer oder irischerAbstammung, 28 Prozent sind Nachkommen französischer Einwanderer.
Amtssprachen sind Englisch und Französisch.
Die überwiegende Mehrheit Französisch sprechenderEinwohner lebt in der Provinz Quebec, wo Frankokanadier 78 Prozent der Bevölkerung stellen.
Außerdem leben in Kanada Nachfahren von Einwanderern aus vielen andereneuropäischen Ländern wie Deutschland, Italien, Polen, der Niederlande und der Ukraine.
Während der letzten Jahre erfolgte eine verstärkte Zuwanderung von Asiaten, vorallem aus Indien, Vietnam und Hongkong.
Der Anteil indianischer Ureinwohner an der Gesamtbevölkerung liegt nur noch bei etwa 2 Prozent, steigt aber gegenwärtig an.
DieAngehörigen der knapp 600 Indianerstämme leben über das gesamte Land verteilt, während die etwa 30 000 Eskimo überwiegend im Norden ansässig sind.
Die Einwohnerzahl Kanadas beträgt 33,68 Millionen.
Die Bevölkerungsdichte liegt bei 3,7 Einwohnern je Quadratkilometer.
Siedlungsschwerpunkt ist ein etwa 300 Kilometerbreiter Gürtel entlang der Grenze zu den Vereinigten Staaten im Südosten Kanadas.
62 Prozent der Landesbevölkerung leben in den Provinzen Ontario und Quebec.
WeiteTeile im Nordwesten des Landes sind nahezu menschenleer.
3.1 Wichtige Städte
Mit 81 Prozent ist der Anteil der Stadtbevölkerung sehr hoch (2005).
Toronto, eine Hafenstadt am Ontariosee und ein bedeutendes Produktionszentrum, ist mit2,50 Millionen Einwohnern größte Stadt des Landes.
Die Einwohnerzahl der Handelsmetropole Montreal beträgt 1,04 Millionen, die Hafenstadt Vancouver hat578 000 Einwohner .
Weitere größere Städte sind die Hauptstadt Ottawa (812 000), Edmonton (730 000) und Calgary (988 000 Einwohner).
3.2 Sprache
Die Amtssprachen in Kanada sind Englisch und Französisch.
Das kanadische Englisch unterscheidet sich nur wenig vom amerikanischen Englisch.
In Ontario und Manitobawird von etwa 5 Prozent der Bevölkerung Französisch gesprochen.
In den westlichen Provinzen sprechen die meisten Menschen Englisch.
In den atlantischen Provinzen wirdhauptsächlich Englisch gesprochen, wenngleich etwa ein Drittel der Bevölkerung von New Brunswick Französisch spricht.
In Québec ist Französisch die wichtigste Sprache.Im Siedlungsgebiet der Indianer und Eskimo gibt es mehr als 50 verschiedene Sprachen.
Siehe auch Indianersprachen
3.3 Religion
87 Prozent der Bevölkerung sind Christen (47 Prozent Katholiken, 40 Prozent Protestanten).
Besonders stark ist die katholische Glaubensgemeinschaft mit einem Anteil von88 Prozent in der Provinz Quebec.
Größte protestantische Glaubensgruppen sind Anglikaner und Anhänger der Vereinigten Kanadischen Kirche.
Außerdem leben in KanadaMuslime, Hindus und Anhänger weiterer kleiner Glaubensgemeinschaften.
8 Prozent der Bewohner sind konfessionslos.
3.3. 1 Feiertage
Der Neujahrstag (1.
Januar) ist der erste Feiertag im Jahr.
Im Frühling feiern die Christen Ostern (Karfreitag bis Ostermontag).
Am Viktoriatag, der am dritten Montag imMai begangen wird, wird des Geburtstags von Königin Viktoria und des Britischen Commonwealth gedacht.
Am Kanadatag (1.
Juli) gedenkt man feierlich des British North American Acts von 1867, der die verschiedenen Teile Kanadas vereinte.
Am ersten Montag im September begehen die Kanadier den Tag der Arbeit.
Am zweiten Montag im Oktober findet das Erntedankfest statt.
Der 11.
November ist der Gedenktag für die Gefallenen des 1.
und 2.
Weltkrieges.
Im letzten Monat des Jahres begeht man denersten und den zweiten Weihnachtsfeiertag (25.
und 26.
Dezember).
Zu diesen nationalen kommen noch einige Feiertage hinzu, die nur auf Provinzebene begangen werden.
4 BILDUNG UND KULTUR
Das kanadische Bildungssystem liegt im Zuständigkeitsbereich der Provinzen und orientiert sich an britischem und amerikanischem, in der Provinz Quebec vorwiegend anfranzösischem Vorbild.
Die Schulen in den direkt der kanadischen Regierung unterstellten Territorien werden von dieser ebenso verwaltet, wie die Bildungseinrichtungen fürIndianer und Eskimo.
Unterrichtssprachen sind Englisch und Französisch.
Aufgrund der dünnen Besiedlung und der englisch-französischen Gegensätze bildete sich keineeinheitliche Nationalkultur.
Die Einwanderer aller Volksgruppen und Nationalitäten konnten ihr kulturelles Erbe bewahren.
Vermischung unterschiedlicher Strömungen führtevor allem in Großstädten zum Phänomen der multikulturellen Gesellschaft.
Das Land bietet zahlreiche Sehenswürdigkeiten wie Museen und historische Stätten..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Kanada - Daten und Fakten - geographie.
- Travail Geographie Sur Les Fabrications Matérielles: Chaine de Valeur d'un Objet : L'Iphone 12
- histoire geographie developpement et inegalites dans le monde
- cours de geographie, la france en ville
- PROGRAGRAMME D'HISTOIRE GEOGRAPHIE DU CRPE 2007 Fiche composée par sylvain sylvain.