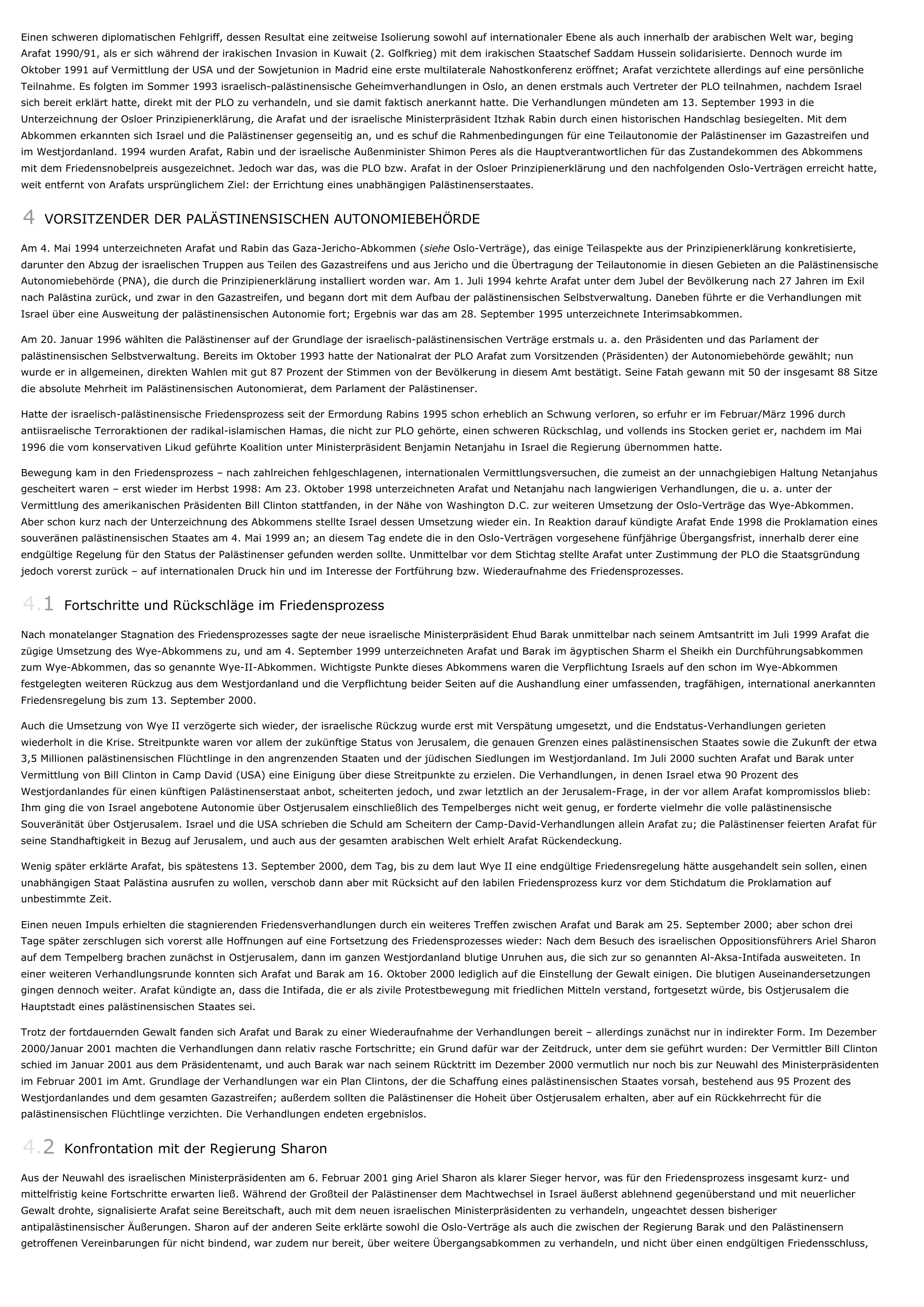Jasir Mohammed Arafat - Geschichte.
Publié le 15/06/2013
Extrait du document


«
Einen schweren diplomatischen Fehlgriff, dessen Resultat eine zeitweise Isolierung sowohl auf internationaler Ebene als auch innerhalb der arabischen Welt war, begingArafat 1990/91, als er sich während der irakischen Invasion in Kuwait (2.
Golfkrieg) mit dem irakischen Staatschef Saddam Hussein solidarisierte.
Dennoch wurde imOktober 1991 auf Vermittlung der USA und der Sowjetunion in Madrid eine erste multilaterale Nahostkonferenz eröffnet; Arafat verzichtete allerdings auf eine persönlicheTeilnahme.
Es folgten im Sommer 1993 israelisch-palästinensische Geheimverhandlungen in Oslo, an denen erstmals auch Vertreter der PLO teilnahmen, nachdem Israelsich bereit erklärt hatte, direkt mit der PLO zu verhandeln, und sie damit faktisch anerkannt hatte.
Die Verhandlungen mündeten am 13.
September 1993 in dieUnterzeichnung der Osloer Prinzipienerklärung, die Arafat und der israelische Ministerpräsident Itzhak Rabin durch einen historischen Handschlag besiegelten.
Mit demAbkommen erkannten sich Israel und die Palästinenser gegenseitig an, und es schuf die Rahmenbedingungen für eine Teilautonomie der Palästinenser im Gazastreifen undim Westjordanland.
1994 wurden Arafat, Rabin und der israelische Außenminister Shimon Peres als die Hauptverantwortlichen für das Zustandekommen des Abkommensmit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet.
Jedoch war das, was die PLO bzw.
Arafat in der Osloer Prinzipienerklärung und den nachfolgenden Oslo-Verträgen erreicht hatte,weit entfernt von Arafats ursprünglichem Ziel: der Errichtung eines unabhängigen Palästinenserstaates.
4 VORSITZENDER DER PALÄSTINENSISCHEN AUTONOMIEBEHÖRDE
Am 4.
Mai 1994 unterzeichneten Arafat und Rabin das Gaza-Jericho-Abkommen ( siehe Oslo-Verträge), das einige Teilaspekte aus der Prinzipienerklärung konkretisierte, darunter den Abzug der israelischen Truppen aus Teilen des Gazastreifens und aus Jericho und die Übertragung der Teilautonomie in diesen Gebieten an die PalästinensischeAutonomiebehörde (PNA), die durch die Prinzipienerklärung installiert worden war.
Am 1.
Juli 1994 kehrte Arafat unter dem Jubel der Bevölkerung nach 27 Jahren im Exilnach Palästina zurück, und zwar in den Gazastreifen, und begann dort mit dem Aufbau der palästinensischen Selbstverwaltung.
Daneben führte er die Verhandlungen mitIsrael über eine Ausweitung der palästinensischen Autonomie fort; Ergebnis war das am 28.
September 1995 unterzeichnete Interimsabkommen.
Am 20.
Januar 1996 wählten die Palästinenser auf der Grundlage der israelisch-palästinensischen Verträge erstmals u.
a.
den Präsidenten und das Parlament derpalästinensischen Selbstverwaltung.
Bereits im Oktober 1993 hatte der Nationalrat der PLO Arafat zum Vorsitzenden (Präsidenten) der Autonomiebehörde gewählt; nunwurde er in allgemeinen, direkten Wahlen mit gut 87 Prozent der Stimmen von der Bevölkerung in diesem Amt bestätigt.
Seine Fatah gewann mit 50 der insgesamt 88 Sitzedie absolute Mehrheit im Palästinensischen Autonomierat, dem Parlament der Palästinenser.
Hatte der israelisch-palästinensische Friedensprozess seit der Ermordung Rabins 1995 schon erheblich an Schwung verloren, so erfuhr er im Februar/März 1996 durchantiisraelische Terroraktionen der radikal-islamischen Hamas, die nicht zur PLO gehörte, einen schweren Rückschlag, und vollends ins Stocken geriet er, nachdem im Mai1996 die vom konservativen Likud geführte Koalition unter Ministerpräsident Benjamin Netanjahu in Israel die Regierung übernommen hatte.
Bewegung kam in den Friedensprozess – nach zahlreichen fehlgeschlagenen, internationalen Vermittlungsversuchen, die zumeist an der unnachgiebigen Haltung Netanjahusgescheitert waren – erst wieder im Herbst 1998: Am 23.
Oktober 1998 unterzeichneten Arafat und Netanjahu nach langwierigen Verhandlungen, die u.
a.
unter derVermittlung des amerikanischen Präsidenten Bill Clinton stattfanden, in der Nähe von Washington D.C.
zur weiteren Umsetzung der Oslo-Verträge das Wye-Abkommen.Aber schon kurz nach der Unterzeichnung des Abkommens stellte Israel dessen Umsetzung wieder ein.
In Reaktion darauf kündigte Arafat Ende 1998 die Proklamation einessouveränen palästinensischen Staates am 4.
Mai 1999 an; an diesem Tag endete die in den Oslo-Verträgen vorgesehene fünfjährige Übergangsfrist, innerhalb derer eineendgültige Regelung für den Status der Palästinenser gefunden werden sollte.
Unmittelbar vor dem Stichtag stellte Arafat unter Zustimmung der PLO die Staatsgründungjedoch vorerst zurück – auf internationalen Druck hin und im Interesse der Fortführung bzw.
Wiederaufnahme des Friedensprozesses.
4.1 Fortschritte und Rückschläge im Friedensprozess
Nach monatelanger Stagnation des Friedensprozesses sagte der neue israelische Ministerpräsident Ehud Barak unmittelbar nach seinem Amtsantritt im Juli 1999 Arafat diezügige Umsetzung des Wye-Abkommens zu, und am 4.
September 1999 unterzeichneten Arafat und Barak im ägyptischen Sharm el Sheikh ein Durchführungsabkommenzum Wye-Abkommen, das so genannte Wye-II-Abkommen.
Wichtigste Punkte dieses Abkommens waren die Verpflichtung Israels auf den schon im Wye-Abkommenfestgelegten weiteren Rückzug aus dem Westjordanland und die Verpflichtung beider Seiten auf die Aushandlung einer umfassenden, tragfähigen, international anerkanntenFriedensregelung bis zum 13.
September 2000.
Auch die Umsetzung von Wye II verzögerte sich wieder, der israelische Rückzug wurde erst mit Verspätung umgesetzt, und die Endstatus-Verhandlungen gerietenwiederholt in die Krise.
Streitpunkte waren vor allem der zukünftige Status von Jerusalem, die genauen Grenzen eines palästinensischen Staates sowie die Zukunft der etwa3,5 Millionen palästinensischen Flüchtlinge in den angrenzenden Staaten und der jüdischen Siedlungen im Westjordanland.
Im Juli 2000 suchten Arafat und Barak unterVermittlung von Bill Clinton in Camp David (USA) eine Einigung über diese Streitpunkte zu erzielen.
Die Verhandlungen, in denen Israel etwa 90 Prozent desWestjordanlandes für einen künftigen Palästinenserstaat anbot, scheiterten jedoch, und zwar letztlich an der Jerusalem-Frage, in der vor allem Arafat kompromisslos blieb:Ihm ging die von Israel angebotene Autonomie über Ostjerusalem einschließlich des Tempelberges nicht weit genug, er forderte vielmehr die volle palästinensischeSouveränität über Ostjerusalem.
Israel und die USA schrieben die Schuld am Scheitern der Camp-David-Verhandlungen allein Arafat zu; die Palästinenser feierten Arafat fürseine Standhaftigkeit in Bezug auf Jerusalem, und auch aus der gesamten arabischen Welt erhielt Arafat Rückendeckung.
Wenig später erklärte Arafat, bis spätestens 13.
September 2000, dem Tag, bis zu dem laut Wye II eine endgültige Friedensregelung hätte ausgehandelt sein sollen, einenunabhängigen Staat Palästina ausrufen zu wollen, verschob dann aber mit Rücksicht auf den labilen Friedensprozess kurz vor dem Stichdatum die Proklamation aufunbestimmte Zeit.
Einen neuen Impuls erhielten die stagnierenden Friedensverhandlungen durch ein weiteres Treffen zwischen Arafat und Barak am 25.
September 2000; aber schon dreiTage später zerschlugen sich vorerst alle Hoffnungen auf eine Fortsetzung des Friedensprozesses wieder: Nach dem Besuch des israelischen Oppositionsführers Ariel Sharonauf dem Tempelberg brachen zunächst in Ostjerusalem, dann im ganzen Westjordanland blutige Unruhen aus, die sich zur so genannten Al-Aksa-Intifada ausweiteten.
Ineiner weiteren Verhandlungsrunde konnten sich Arafat und Barak am 16.
Oktober 2000 lediglich auf die Einstellung der Gewalt einigen.
Die blutigen Auseinandersetzungengingen dennoch weiter.
Arafat kündigte an, dass die Intifada, die er als zivile Protestbewegung mit friedlichen Mitteln verstand, fortgesetzt würde, bis Ostjerusalem dieHauptstadt eines palästinensischen Staates sei.
Trotz der fortdauernden Gewalt fanden sich Arafat und Barak zu einer Wiederaufnahme der Verhandlungen bereit – allerdings zunächst nur in indirekter Form.
Im Dezember2000/Januar 2001 machten die Verhandlungen dann relativ rasche Fortschritte; ein Grund dafür war der Zeitdruck, unter dem sie geführt wurden: Der Vermittler Bill Clintonschied im Januar 2001 aus dem Präsidentenamt, und auch Barak war nach seinem Rücktritt im Dezember 2000 vermutlich nur noch bis zur Neuwahl des Ministerpräsidentenim Februar 2001 im Amt.
Grundlage der Verhandlungen war ein Plan Clintons, der die Schaffung eines palästinensischen Staates vorsah, bestehend aus 95 Prozent desWestjordanlandes und dem gesamten Gazastreifen; außerdem sollten die Palästinenser die Hoheit über Ostjerusalem erhalten, aber auf ein Rückkehrrecht für diepalästinensischen Flüchtlinge verzichten.
Die Verhandlungen endeten ergebnislos.
4.2 Konfrontation mit der Regierung Sharon
Aus der Neuwahl des israelischen Ministerpräsidenten am 6.
Februar 2001 ging Ariel Sharon als klarer Sieger hervor, was für den Friedensprozess insgesamt kurz- undmittelfristig keine Fortschritte erwarten ließ.
Während der Großteil der Palästinenser dem Machtwechsel in Israel äußerst ablehnend gegenüberstand und mit neuerlicherGewalt drohte, signalisierte Arafat seine Bereitschaft, auch mit dem neuen israelischen Ministerpräsidenten zu verhandeln, ungeachtet dessen bisherigerantipalästinensischer Äußerungen.
Sharon auf der anderen Seite erklärte sowohl die Oslo-Verträge als auch die zwischen der Regierung Barak und den Palästinenserngetroffenen Vereinbarungen für nicht bindend, war zudem nur bereit, über weitere Übergangsabkommen zu verhandeln, und nicht über einen endgültigen Friedensschluss,.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- ORIGINE ET SENS DE L’HISTOIRE [Ursprung und Sinn der Geschichte] de Karl Jaspers (Résumé et analyse)
- INCENDIE (L’) de Mohammed Dib (résumé & analyse)
- Sultan Mohammed Tabrizi : Diwan de Hafiz
- Z?her Sh?h Mohammed , né à Kaboul en 1914, roi d'Afgh?nist?n de 1933 à 1973, fils et successeur de Nader Sh?h.
- Rudolf Eucken: Einführung in die Geschichte der Philosophie Anthologie.