GOETHE UND HEGEL
Publié le 22/02/2012
Extrait du document
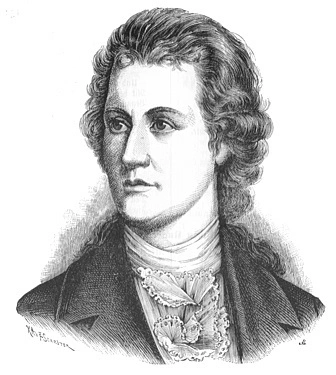
Goethe bildete die deutsche Literatur zur Weltliteratur und Hegel die
deutsche Philosophie zur Weltphilosophie. Ihre Hervorbringungskraft
war von einer vollkommenen Normalität, weil ihr Wollen im Einklang
mit ihrem Können stand. Was nachher kommt, kann sich an
Weite des Umblicks und Energie der Durchdringung nicht damit messen;
es ist überspannt oder abgespannt, extrem oder mittelmäßig und
mehr versprechend als haltend.
Im selben Jahr 1806, als Napoleon durch Jena und Weimar kam,
vollendete Hegel die Phänomenologie des Geistes und Goethe den
ersten Teil des Faust, zwei Werke, in denen die deutsche Sprache ihre
breiteste Fülle und ihre tiefste Dichte erreicht. Doch ist das Verhältnis
von Hegel zu Goethe viel unscheinbarer als das von andern deutschen
Denkern und Dichtern, so daß es den Anschein erweckt, als hätten sie
nur nebeneinander gelebt, ohne miteinander zu wirken. Während
Schiller durch Kant und die Romantiker durch Fichte und Schelling
geprägt sind, ist Goethes Anschauung der natürlichen und menschlichen
Welt durch keinen der klassischen Philosophen bestimmt. Sein
Dichten bedurfte keines philosophischen Rückhalts, weil es in sich selber
gedankenvoll war und seine naturwissenschaftlichen Forschungen
waren von derselben Einbildungskraft geleitet wie seine Dichtung.
Hegel und Goethe kann also nicht bedeuten, daß ihr Lebenswerk von
einander abhängig ist oder unmittelbar ineinander greift, wohl aber
soll die Verbindung andeuten, daß zwischen der Anschauung Goethes
und dem Begreifen Hegels eine innere Beziehung besteht, die sowohl
eine Nähe wie eine Entfernung bezeichnet. Die Anerkennung, die jeder
von beiden dem Werk und dem Wirken des andern zollte, beruht
auf dem Abstand, den ihre Verbindung behielt. Indem aber jeder das
Seine tat, war die Gesinnung, in der sie es taten, doch in entscheidenden
Dingen dieselbe. Die Differenz, welche sie auseinander hält und
vereinigt, wird deutlich, wenn man beachtet, daß Goethes »Urphänotnene
« und das »Absolute« von Hegel sich in der Sache genau so respektvoll
begegnen wie Goethe und Hegel selber in ihrem persönlichen
Leben.2
17
Ihre beiderseitige Beziehung erstreckt sich über drei Jahrzehnte. Einige
Tagebuchaufzeichnungen und mündliche Äußerungen von Goethe sowie
die wenigen Briefe, die zwischen ihnen gewechselt wurden, sind
alles, was ihr Verhältnis dokumentiert. In Hegels Werken wird beiläufig
einige Male auf Goethe verwiesen, ausführlicher mit Bezug auf
die Farbenlehre in den beiden Ausgaben der Encyclopädie.3 Andrerseits
hat Goethe eine Briefstelle Hegels über denselben Gegenstand im
4. Heft zur Naturwissenschaft abgedruckt. Doch ging ihr Verhältnis
über diese sachliche Anteilnahme hinaus.
Hegel schreibt am 24. April 1825 an Goethe von den näheren Motiven
seiner »Anhänglichkeit und selbst Pietät«; »denn wenn ich den
Gang meiner geistigen Entwicklung übersehe, sehe ich Sie überall
darein verflochten und mag mich einen Ihrer Söhne nennen; mein Inneres
hat gegen die Abstraktion Nahrung zu widerhaltender Stärke
von Ihnen erhalten und an Ihren Gebilden wie an Fanalen seinen
Lauf zurechtgerichtet.« 4 Dem entspricht Goethes Äußerung nach Hegels
Tod zu Varnhagen, er empfinde ein tiefes Bedauern über den
Verlust dieses »hochbegabten, bedeutenden Reihenführers«, der ein so
»wohlbegründeter und mannigfach tätiger Mann und Freund« gewesen
sei. »Das Fundament seiner Lehre lag außer meinem Gesichtskreis,
wo aber sein Tun an mich heranreichte oder auch wohl in meine Bestrebungen
eingriff, habe ich immer davon wahren geistigen Vorteil
gehabt.« 5 Noch ferner als das dogmatische Fundament von Hegels
eigener Lehre lagen Goethe die Nachkonstruktionen der Hegelschüler,
obgleich er auch von solchen tüchtige Kenntnisse lobend erwähnt. So
studierte er noch als Achtundsiebzigjähriger ein Buch von Hinrichs
über die antike Tragödie und nahm es zum Ausgangspunkt eines bedeutenden
Gesprächs.6 Einem andern Schüler von Hegel, L. von Henning,
der an der Berliner Universität Vorlesungen über Goethes Farbenlehre
hielt, stellte er das nötige Material zur Verfügung. Zu dem
selbständigsten der damaligen Hegelschüler, dem Rechtsphilosophen
E. Gans, hat sich Goethe nach dessen Bericht in folgender Weise geäußert:
»Er meinte, wenn die Philosophie es sich zur Pflicht mache,
auch auf die Sachen und Gegenstände, welche sie behandelt, Rücksicht
zu nehmen, so dürfte sie um so wirksamer werden, je mehr sie freilich
auch mit den Empirikern zu tun bekomme; nur werde immer die Frage
entstehen, ob es zugleich möglich sei, ein großer Forscher und Beobachter
und auch ein bedeutender Verallgemeinerer und Zusammenfasser
zu sein ... Er traute Hegel zwar sehr viele Kenntnisse in der Natur
wie in der Geschichte zu, ob aber seine philosophischen Gedanken
18
sich nicht immer nach den neuen Entdeckungen, die man doch stets
machen würde, modifizieren müßten, und dadurch selber ihr Kategorisches
verlören, könne er zu fragen doch nicht unterlassen ... Er kam
nunmehr auf die Jahrbücher. Ihm mißfiel eine gewisse Schwerfälligkeit
und Weitläufigkeit, welche in den einzelnen Abhandlungen läge;
er tadelte meine Rezension über Savignys Geschichte des römischen
Rechts im Mittelalter aus dem Gesichtspunkte, daß ich den Autor nötigen
wollte, etwas anderes zu tun, als er im Sinn habe ...« 7
Ebenso wie Goethe hier die Aufnötigung einer fremden Denkweise
ablehnt, betont er in einem Brief an Hegel, es handle sich bei seinen
naturwissenschaftlichen Arbeiten nicht um eine »durchzusetzende Meinung
«, sondern um eine »mitzuteilende Methode«, deren sich jeder
nach seiner Art als eines Werkzeugs bedienen möge.8 Unmittelbar
nach diesem Vorbehalt folgt aber eine Anerkennung von Hegels Bestrebungen,
welche zeigt, wie sehr auch Goethe aller zuchtlosen Willkür
abgeneigt war. »Mit Freuden höre ich von manchen Orten her,
daß Ihre Bemühung, junge Männer nachzubilden, die besten Früchte
bringt; es tut freilich not, daß in dieser wunderlichen Zeit irgendwo
aus einem Mittelpunkt eine Lehre sich verbreite, woraus theoretisch
und praktisch ein Leben zu fördern sei. Die hohlen Köpfe wird man
freilich nicht hindern, sich in vagen Vorstellungen und tönenden Wortschällen
zu ergehen; die guten Köpfe jedoch sind auch übel daran,
denn, indem sie falsche Methoden gewahren, in die man sie von Jugend
auf verstrickte, ziehen sie sich auf sich selbst zurück, werden abstrus
oder transzendieren.« 9 Der Wille zu einer überlieferbaren Gründung
verband Goethe, über Hegels »Lehre« hinweg, mit dessen geistigem
»Tun«. Diese für das ganze Verhältnis von Goethe zu Hegel
charakteristische Unterscheidung äußert sich drastisch in einem Gespräch
mit dem Kanzler Müller: »Ich mag nichts Näheres von der Hegelschen
Philosophie wissen, wiewohl Hegel selbst mir ziemlich zusagt.
« 10 Konzilianter schreibt Goethe an Hegel selber etwas später:
»Ich halte meinen Sinn möglichst offen für die Gaben des Philosophen
und freue mich jedesmal, wenn ich mir zueignen kann, was auf eine
Weise erforscht wird, welche die Natur mir nicht hat zugestehen wollen.
«11 So fühlte sich Goethe zeitlebens von Hegels Philosophie zugleich
angezogen und abgestoßen, und doch war er im Grunde gewiß,
daß sie im Geiste einander begegneten. Wundersam spricht sich
dies aus in seinem letzten Brief an Zelter: »Glücklicherweise ist Dein
Talentcharakter auf den Ton, das heißt auf den Augenblick angewiesen.
Da nun eine Folge von konsequenten Augenblicken immer eine
Art von Ewigkeit selbst ist, so war Dir gegeben, im Vorübergehenden
stets beständig zu sein und also mir sowohl als Hegels Geist, insofern
ich ihn verstehe, völlig genug zu tun.« 13
Liens utiles
- Nietzsches Beurteilung von Goethe und Hegel
- Das Ende der von Goethe und Hegel vollendeten Welt
- Je suis libre quand je suis auprès de moi (Hegel
- L'indicible chez Bergson et Hegel
- L'art selon Hegel































