Das Ende der von Goethe und Hegel vollendeten Welt
Publié le 22/02/2012
Extrait du document
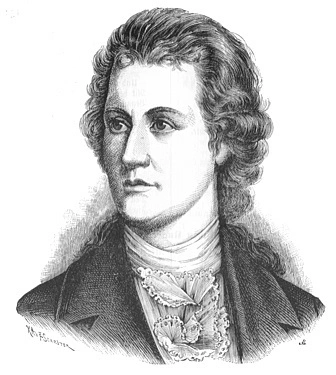
Goethe äußerte sich 1829 zu dem Polen Odynic in einem Gespräch
über die Lage Europas, daß das 19. Jahrhundert »nicht einfach die
Fortsetzung der früheren sei, sondern zum Anfang einer neuen Ära
bestimmt scheine. Denn solche große Begebenheiten, wie sie die Welt
in seinen ersten Jahren erschütterten, könnten nicht ohne große, ihnen
entsprechende Folgen bleiben, wenngleich diese, wie das Getreide aus
der Saat, langsam wachsen und reifen«.64 Goethe erwartete sie nicht
früher als im Herbst des Jahrhunderts. Die nächste Folge war die
Julirevolution von 1830, welche ganz Europa erschütterte und allen
Zeitgenossen zu denken gab. Immermann meinte, man könne sie nicht
aus einer physischen Not erklären, sondern nur aus einem geistigen
Drang und einer Begeisterung, ähnlich einer religiösen Bewegung,
wenngleich das Agens statt des Glaubens »das Politische« sei. Nüchterner
hat sie L. von Stein als den großen Akt beurteilt, durch den die
industrielle Gesellschaft zur Herrschaft kam. Die sozialen Wahrheiten,
denen sie Geltung verschaffte, seien allgemein europäische und der
40
Zweifel, der sich an den Sieg der bürgerlichen Klasse knüpfe, betreffe
die Zivilisation überhaupt. Als epochal empfand vor allem Niebuhr
den Umsturz. Seine tief resignierte Vorrede zur 2. Auflage des zweiten
Teiles der Römischen Geschichte vom 5. Oktober 1830 sieht »jedes
erfreuliche Verhältnis« durch eine Zerstörung bedroht, wie die römische
Welt sie um das dritte Jahrhundert erfuhr: Vernichtung des
Wohlstands, der Freiheit, der Bildung, der Wissenschaft. Und Goethe
gab ihm Recht, wenn er eine künftige Barbarei prophezeite; sie sei sogar
schon da, »wir sind schon mitten darinne«.65
Die symptomatische Bedeutung der Julirevolution war, daß sie zeigte,
daß sich der Abgrund der großen Französischen Revolution nur
scheinbar geschlossen hatte und man sich in Wirklichkeit erst am Anfang
eines ganzen »Zeitalters von Revolutionen« befand, in dem die
Masse gegenüber den Ständen eine eigene politische Macht gewann.66
Der Kanzler Müller berichtet von einem Gespräch mit Goethe, worin
dieser geäußert hat, er könne sich über die neue Krisis nur dadurch
beruhigen, daß er sie für »die größte Denkübung« ansehe, die ihm am
Schluß seines Lebens habe werden können.67 Einige Monate später
schreibt Goethe an Zelter, es komme ihm wundersam vor, daß sich
nach vierzig Jahren der alte Taumel wieder erneuere. Alle Klugheit
der noch bestehenden Mächte liege darin, daß sie die einzelnen Paroxysmen
unschädlich machen. »Kommen wir darüber hinaus, so ists
wieder auf eine Weile ruhig. Mehr sag ich nicht.« 68 Ungehöriger als
je schien ihm in dieser Revolution ein »unvermitteltes Streben ins Unbedingte
« zu wollen — »in dieser durchaus bedingten Welt.« 69 Er selber
rettete sich in das Studium der Natur, welche inmitten aller Veränderungen
beständig bleibt. Als ihm Eckermann die ersten Nachrichten
von der Revolution überbringen wollte, rief ihm Goethe entgegen:
»Nun, was denken Sie von dieser großen Begebenheit? Der Vulkan ist
zum Ausbruch gekommen, alles steht in Flammen und es ist nicht ferner
eine Verhandlung bei geschlossenen Türen.« Mit dieser Begebenheit
meinte er aber zum Erstaunen Eckermanns nicht die politischen
Ereignisse, sondern eine Diskussion in der Akademie von Paris, welche
die Methode der Naturforschung anging.70
Daß die Welt um 1830 infolge der demokratischen Nivellierung und
Industrialisierung anders zu werden begann, hat Goethe deutlich erkannt.
Er sagte am 23. Oktober 1828 zu Eckermann über die Menschheit:
»Ich sehe die Zeit kommen, wo Gott keine Freude mehr an ihr
hat und er abermals alles zusammenschlagen muß zu einer verjüngten
Schöpfung.« Der Boden der bürgerlichen Gesellschaft und ihrer Gesel-
41
ligkeit schien ihm zerstört und als den geistvollen Entwurf einer radikalen
Vernichtung der bestehenden Ordnung beachtete er die Schriften
von Saint-Simon. Was ihm an moderner Literatur aus Frankreich
zukam, erkannte er als eine »Literatur der Verzweiflung«, welche
dem Leser das Entgegengesetzte von all dem aufdränge, was man dem
Menschen zu einigem Heil vortragen sollte.71 »Das Häßliche, das Abscheuliche,
das Grausame, das Nichtswürdige mit der ganzen Sippschaft
des Verworfenen ins Unmögliche zu überbieten, ist ihr satanisches
Geschäft.« Alles sei jetzt »ultra« und »transzendiere« im Denken
wie im Tun. »Niemand kennt sich mehr, niemand begreift das Element,
worin er schwebt und wirkt, niemand den Stoff, den er bearbeitet.
Von reiner Einfalt kann die Rede nicht sein; einfältiges Zeug
gibt es genug.« Die moderne Menschheit überbiete und überbilde sich,
um in der Mittelmäßigkeit zu verharren, sie werde extremer und gemeiner.
72 Das letzte Dokument seiner Einsicht in die Bewegung der
Zeit ist ein Brief an W. von Humboldt, worin er seine Versiegelung
des zweiten Teiles des Faust folgendermaßen begründet: »Ganz ohne
Frage würde es mir unendliche Freude machen, meinen werten, durchaus
dankbar anerkannten, weitverteilten Freunden auch bei Lebzeiten
diese sehr ernsten Scherze zu widmen, mitzuteilen und ihre Erwiderung
zu vernehmen. Der Tag aber ist wirklich so absurd und konfus,
daß ich mich überzeuge, meine redlichen, langverfolgten Bemühungen
um dieses seltsame Gebäu würden schlecht belohnt und an den Strand
getrieben, wie ein Wrack in Trümmern daliegen und von dem Dünenschutt
der Stunden zunächst überschüttet werden. Verwirrende Lehre
zu verwirrtem Handel waltet über die Welt, und ich habe nichts angelegentlicher
zu tun, als dasjenige, was an mir ist und geblieben ist,
womöglich zu steigern und meine Eigentümlichkeiten zu kohobieren,
wie Sie es, würdiger Freund, auf Ihrer Burg ja auch bewerkstelligen.«
Mit diesen Worten voll wunderbarer Entschiedenheit und Gelassenheit
endet, fünf Tage vor seinem Tode, Goethes Korrespondenz.
Nicht minder als Goethe wurde Hegel durch die Julirevolution irritiert.
Mit Empörung und Schrecken bemerkte er den Einbruch neuer
Entzweiungen, gegen die er nun das Bestehende wie einen wahren Bestand
verteidigte. In seiner letzten politischen Schrift von 1831, zur
Kritik der englischen Reformbill, charakterisierte er schon den Willen
zu einer Reform als ein »Nichtgehorchen« aus dem »Mut von unten«.
Angegriffen vom Vorwurf der Servilität gegenüber Kirche und Staat,
schrieb er am 13. XII. 1830 an Goeschel: »Doch hat gegenwärtig das
ungeheure politische Interesse alle andern verschlungen, - eine Krise,
42
in der Alles, was sonst gegolten, problematisch gemacht zu werden
scheint. So wenig sich die Philosophie der Unwissenheit, der Gewalttätigkeit
und den bösen Leidenschaften dieses lauten Lärms entgegenstellen
kann, so glaube ich kaum, daß sie in jene Kreise, die sich so
bequem gebettet, eindringen könne; sie darf es sich - auch zum Behuf
der Beruhigung - bewußt werden, daß sie nur für Wenige sei.« Und
in der Vorrede zur 2. Auflage der Logik spricht er am Schluß die Befürchtung
aus, ob in einer politisch so aufgeregten Zeit überhaupt noch
Raum sei für die »leidenschaftslose Stille der nur denkenden Erkenntnis
«. Wenige Tage nach dem Abschluß der Vorrede erkrankte er an
der Cholera und starb.
Während Goethe und Hegel in der gemeinsamen Abwehr des »Transzendierenden
« noch eine Welt zu gründen vermochten, worin der
Mensch bei sich sein kann, haben schon ihre nächsten Schüler sich nicht
mehr in ihr zu Hause gefunden und das Gleichgewicht ihrer Meister
als das Produkt einer bloßen Harmonisierung verkannt.73 — Die Mitte,
aus der Goethes Natur heraus lebte, und die Vermittlung, in der Hegels
Geist sich bewegte, sie haben sich bei Marx und Kierkegaardli
wieder in die beiden Extreme der Äußerlichkeit und der Innerlichkeit
auseinandergesetzt, bis schließlich Nietzsche, durch ein neues Beginnen,
aus dem Nichts der Modernität die Antike zurückholen wollte und bei
diesem Experiment im Dunkel des Irrsinns verschwand.
Liens utiles
- Fußball 1 EINLEITUNG Fußball, Ballspiel für zwei Mannschaften zu je elf Spielern (ein Torhüter und zehn Feldspieler), das beliebteste und am weitesten verbreitete Mannschaftsspiel der Welt.
- Mitose Mitose, zentraler Prozess der Zellteilung von Eukaryonten, wobei im Zellkern das Erbgut (die Nucleinsäure DNA) verdoppelt und auf die zukünftigen Tochterzellen verteilt wird.
- DTIMP020 ITALIEN Oberfläche : 301 277 km2 Höchste Erhebung : Monte Bianco von Courmayeur 4 765 m Außer der italienischen Halbinsel umfaßt das Territorium noch die zwei größten Mittelmeerinseln, Sardinien und Sizilien.
- Andorra wird gemeinsam regiert vom Bischof von Urgel und dem Präsidenten der Französischen Republik; es ist das höchstgelegene bewohnte Land Europas.
- Nietzsches Beurteilung von Goethe und Hegel































