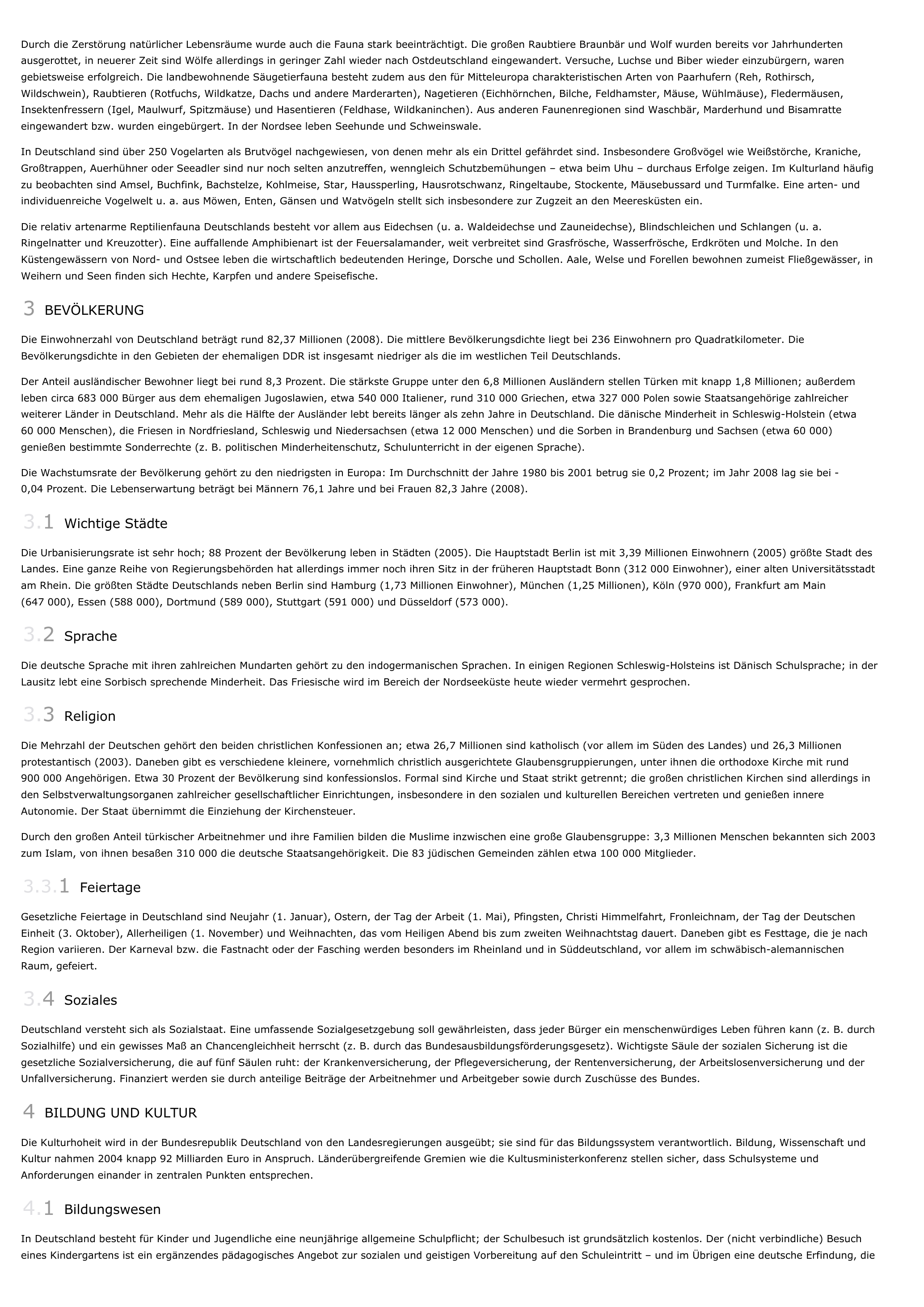Bundesrepublik Deutschland - geographie. 1 EINLEITUNG Bundesrepublik Deutschland, Land in Mitteleuropa, grenzt im Norden an die Nordsee, an Dänemark und an die Ostsee, im Osten an Polen und die Tschechische Republik, im Süden an Österreich und die Schweiz und im Westen an Frankreich, Luxemburg, Belgien und die Niederlande. Die amtliche Bezeichnung lautet Bundesrepublik Deutschland (BRD). Die Gesamtfläche des Landes beträgt 356 970 Quadratkilometer. Hauptstadt und zugleich größte Stadt Deutschlands ist Berlin. 2 LAND Die maximale Ausdehnung beträgt von Norden nach Süden circa 880 Kilometer und von Westen nach Osten rund 750 Kilometer. 2.1 Physische Geographie Deutschland gliedert sich in drei geographische Großräume - das Norddeutsche Tiefland, die Mittelgebirgszone und die Alpen mit Alpenvorland. Das Norddeutsche Tiefland wurde während der Eiszeiten des Pleistozäns überformt und wird von Moränen, Niederungen und Heidelandschaft (Lüneburger Heide) geprägt. Die Nordseeküste ist eine ausgesprochene Wattenküste; ihr sind zahlreiche Inseln vorgelagert, darunter die Ost- und die Nordfriesischen Inseln sowie Helgoland. Die Küste wird durch die Mündungen mehrerer Flüsse (u. a. Elbe, Weser und Ems) gegliedert. An das die Nordseeküste säumende Marschland schließt landeinwärts sandige Geest an. Die Ostseeküste ist im Bereich von Schleswig-Holstein als typische Fördenküste, weiter nach Osten hin als Boddenküste entwickelt. Rügen ist mit einer Fläche von 930 Quadratkilometern die größte Insel Deutschlands. Die Jungmoränenlandschaft im Hinterland der Ostseeküste umfasst im Westen zahlreiche Moore. Der nach Osten hin anschließende Mecklenburgische Höhenrücken, eine kuppige Grundmoränenlandschaft, ist überaus seenreich; einen besonders eindrucksvollen Landschaftsraum bildet die Mecklenburgische Seenplatte. Nach Süden geht dieser Landrücken in die Märkische Tiefebene über, zu der ausgedehnte Niederungen wie Spreewald, Oderbruch und Havelland gehören. Eine Altmoränenlandschaft (u. a. mit Niederlausitz, Fläming und Altmark) schließt an diese Niederungen nach Süden an. Das Norddeutsche Tiefland endet im Süden in der Bördenzone; sie umfasst mehrere vor den Mittelgebirgen gelegene lößbedeckte Gebiete (u. a. Niederrheinische Bucht, Magdeburger Börde und Leipziger Tieflandsbucht). Die Mittelgebirgszone reicht vom Rheinischen Schiefergebirge im Westen über das Hessische Bergland, das Weser- und das Leinebergland, den Harz, das Thüringer Becken und das Fichtelgebirge bis zu den Sudeten im Osten. Vom dicht bewaldeten Fichtelgebirge gehen nach Nordwesten der Frankenwald und der Thüringer Wald, nach Nordosten das Erzgebirge und in südöstlicher Richtung der Böhmerwald mit Oberpfälzer Wald und Bayerischem Wald aus. Im südwestlichen Deutschland war der Einbruch des rund 300 Kilometer langen Oberrheingrabens von entscheidender Bedeutung für die Ausprägung der Landschaftsformen. Im Zuge der Grabenbildung entstand westlich des Rheins der Pfälzer Wald, auf der Ostseite kam es zur Bildung von Spessart, Odenwald und Schwarzwald. Das aus Schwäbischer und Fränkischer Alb bestehende Schwäbisch-Fränkische Schichtstufenland weist aufgrund des verbreitet auftretenden Kalkgesteins typische Verkarstungserscheinungen auf. Die Donau markiert die Grenze zwischen der Schichtstufenlandschaft und dem südlich anschließenden Alpenvorland. In den Niederungen der nördlichen Bereiche dieses Naturraums sind stellenweise Moorgebiete wie das Donaumoos und fruchtbare Lößgebiete (z. B. Hallertau) entwickelt. Nach Süden hin prägen im Zuge der pleistozänen Eiszeiten entstandene Schotterflächen, Moränen und Seen das Landschaftsbild. Im äußersten Süden hat Deutschland Anteil an den Nördlichen Kalkalpen. Die Zugspitze ist mit 2 962 Metern der höchste Berg des Landes. 2.2 Flüsse und Seen Mit Ausnahme des Rheins, dessen Quellgebiet in den Schweizer Alpen liegt, entspringen die längsten Flüsse Deutschlands in der Mittelgebirgszone. Auf deutschem Gebiet ist der insgesamt 1 320 Kilometer lange Rhein der längste Strom; er durchquert das Land im Südwesten und Westen auf einer Länge von 865 Kilometern. Auch die anderen Hauptströme wie Elbe, Donau und Oder sind für die Schifffahrt von großer Bedeutung. Die Süddeutschland von Westen nach Osten durchziehende Donau mündet in das Schwarze Meer, während die anderen Hauptflüsse nach Norden strömen und in die Nordsee bzw. die Ostsee münden. Ems, Weser, Elbe und Oder werden durch ein stellenweise fein verzweigtes Kanalsystem miteinander verbunden. Der Nord-Ostsee-Kanal stellt eine Verbindung zwischen beiden Randmeeren her. Der umstrittene MainDonau-Kanal ist Teil des Binnenwasserstraßensystems zwischen dem Schwarzen Meer und der Nordsee. Viele Seen in Deutschland sind im Zuge der Tätigkeit von Gletschern und Inlandeismassen der letzten Eiszeiten entstanden. Seenreich sind vor allem Holstein, Mecklenburg (Mecklenburgische Seenplatte) und Vorpommern sowie das östliche Alpenvorland. Die durch vulkanische Aktivität entstandenen Maarseen der Eifel stellen eine landschaftliche Besonderheit dar. Größter See des Landes ist der insgesamt 540 Quadratkilometer große Bodensee, der auch auf das Staatsgebiet von Österreich und der Schweiz übergreift; er erstreckt sich in Deutschland über 305 Quadratkilometer. 2.3 Klima Deutschland liegt im Übergangsbereich zwischen dem ozeanisch beeinflussten Klima Westeuropas und dem kontinentalen Klima des östlichen Europa. Die nördlichen Landesteile sind aufgrund der Nähe zu Nord- und Ostsee maritimer geprägt als der Süden, in dem die Temperaturunterschiede im Jahresverlauf größer sind. Die durchschnittliche Jahrestemperatur liegt landesweit bei 9 °C. Im Januar beträgt die mittlere Temperatur im Norden um 0 °C, im Süden etwa -2 °C; im Juli liegen die Werte bei 17 °C bzw. 19 °C. Am Funtensee im Nationalpark Berchtesgaden wurde am 25. Dezember 2001 mit -45,9 °C die tiefste Temperatur in Deutschland seit Beginn der Wetteraufzeichnungen registriert. Charakteristisch für das Klima in Deutschland sind das Vorherrschen von Westwetterlagen und die Unbeständigkeit des Wetters. Aufgrund der relativ geringen Höhenlage und der Abschirmung durch Mittelgebirge ist das obere Rheintal klimatisch begünstigt. Niederschläge fallen zu allen Jahreszeiten, Hauptregenzeit ist jedoch der Sommer. Die Jahresniederschläge reichen von etwa 500 Millimetern in den Leelagen der Mittelgebirge bis zu mehr als 2 000 Millimetern in den Hochlagen der Alpen. Im Norddeutschen Tiefland werden circa 700 Millimeter erreicht, in den windexponierten Lagen der Mittelgebirge 800 bis 1 400 Millimeter. Eine Besonderheit im Alpenvorland ist der Föhn, ein warmer Fallwind aus südlichen Richtungen. 2.4 Flora und Fauna Das Gebiet des heutigen Deutschland war vor Beginn der Siedlungstätigkeit des Menschen fast ausschließlich von Wald bedeckt; zu den wenigen unbewaldeten Lebensräumen gehörten (neben den Gewässern) Moore, Flussauen und Hochgebirgsregionen. Heute ist die natürliche Vegetation weitgehend zerstört. Wälder, die hinsichtlich Baumartenzusammensetzung und Altersklassenstruktur der Bäume mit den ursprünglichen Naturwäldern nur wenig zu tun haben, nehmen rund 31 Prozent der Landesfläche ein (2005); die größten Waldanteile gibt es in Bayern und Baden-Württemberg. Etwa zwei Drittel der Waldfläche sind von Fichten, Kiefern und anderen Nadelbäumen bedeckt, der Rest von Laubbäumen wie Buchen, Birken und Eichen. Dem Waldschadensbericht 2001 zufolge sind 42 Prozent der Bäume leicht und 22 Prozent stark geschädigt. Von den Schäden betroffen sind insbesondere Eichen und Buchen, von denen nur 21 bzw. 25 Prozent als gesund gelten. Seit 1996 ist der Zustand der Waldbäume trotz deutlicher Reduktion des Schwefeldioxidausstoßes praktisch unverändert. Durch die Zerstörung natürlicher Lebensräume wurde auch die Fauna stark beeinträchtigt. Die großen Raubtiere Braunbär und Wolf wurden bereits vor Jahrhunderten ausgerottet, in neuerer Zeit sind Wölfe allerdings in geringer Zahl wieder nach Ostdeutschland eingewandert. Versuche, Luchse und Biber wieder einzubürgern, waren gebietsweise erfolgreich. Die landbewohnende Säugetierfauna besteht zudem aus den für Mitteleuropa charakteristischen Arten von Paarhufern (Reh, Rothirsch, Wildschwein), Raubtieren (Rotfuchs, Wildkatze, Dachs und andere Marderarten), Nagetieren (Eichhörnchen, Bilche, Feldhamster, Mäuse, Wühlmäuse), Fledermäusen, Insektenfressern (Igel, Maulwurf, Spitzmäuse) und Hasentieren (Feldhase, Wildkaninchen). Aus anderen Faunenregionen sind Waschbär, Marderhund und Bisamratte eingewandert bzw. wurden eingebürgert. In der Nordsee leben Seehunde und Schweinswale. In Deutschland sind über 250 Vogelarten als Brutvögel nachgewiesen, von denen mehr als ein Drittel gefährdet sind. Insbesondere Großvögel wie Weißstörche, Kraniche, Großtrappen, Auerhühner oder Seeadler sind nur noch selten anzutreffen, wenngleich Schutzbemühungen - etwa beim Uhu - durchaus Erfolge zeigen. Im Kulturland häufig zu beobachten sind Amsel, Buchfink, Bachstelze, Kohlmeise, Star, Haussperling, Hausrotschwanz, Ringeltaube, Stockente, Mäusebussard und Turmfalke. Eine arten- und individuenreiche Vogelwelt u. a. aus Möwen, Enten, Gänsen und Watvögeln stellt sich insbesondere zur Zugzeit an den Meeresküsten ein. Die relativ artenarme Reptilienfauna Deutschlands besteht vor allem aus Eidechsen (u. a. Waldeidechse und Zauneidechse), Blindschleichen und Schlangen (u. a. Ringelnatter und Kreuzotter). Eine auffallende Amphibienart ist der Feuersalamander, weit verbreitet sind Grasfrösche, Wasserfrösche, Erdkröten und Molche. In den Küstengewässern von Nord- und Ostsee leben die wirtschaftlich bedeutenden Heringe, Dorsche und Schollen. Aale, Welse und Forellen bewohnen zumeist Fließgewässer, in Weihern und Seen finden sich Hechte, Karpfen und andere Speisefische. 3 BEVÖLKERUNG Die Einwohnerzahl von Deutschland beträgt rund 82,37 Millionen (2008). Die mittlere Bevölkerungsdichte liegt bei 236 Einwohnern pro Quadratkilometer. Die Bevölkerungsdichte in den Gebieten der ehemaligen DDR ist insgesamt niedriger als die im westlichen Teil Deutschlands. Der Anteil ausländischer Bewohner liegt bei rund 8,3 Prozent. Die stärkste Gruppe unter den 6,8 Millionen Ausländern stellen Türken mit knapp 1,8 Millionen; außerdem leben circa 683 000 Bürger aus dem ehemaligen Jugoslawien, etwa 540 000 Italiener, rund 310 000 Griechen, etwa 327 000 Polen sowie Staatsangehörige zahlreicher weiterer Länder in Deutschland. Mehr als die Hälfte der Ausländer lebt bereits länger als zehn Jahre in Deutschland. Die dänische Minderheit in Schleswig-Holstein (etwa 60 000 Menschen), die Friesen in Nordfriesland, Schleswig und Niedersachsen (etwa 12 000 Menschen) und die Sorben in Brandenburg und Sachsen (etwa 60 000) genießen bestimmte Sonderrechte (z. B. politischen Minderheitenschutz, Schulunterricht in der eigenen Sprache). Die Wachstumsrate der Bevölkerung gehört zu den niedrigsten in Europa: Im Durchschnitt der Jahre 1980 bis 2001 betrug sie 0,2 Prozent; im Jahr 2008 lag sie bei 0,04 Prozent. Die Lebenserwartung beträgt bei Männern 76,1 Jahre und bei Frauen 82,3 Jahre (2008). 3.1 Wichtige Städte Die Urbanisierungsrate ist sehr hoch; 88 Prozent der Bevölkerung leben in Städten (2005). Die Hauptstadt Berlin ist mit 3,39 Millionen Einwohnern (2005) größte Stadt des Landes. Eine ganze Reihe von Regierungsbehörden hat allerdings immer noch ihren Sitz in der früheren Hauptstadt Bonn (312 000 Einwohner), einer alten Universitätsstadt am Rhein. Die größten Städte Deutschlands neben Berlin sind Hamburg (1,73 Millionen Einwohner), München (1,25 Millionen), Köln (970 000), Frankfurt am Main (647 000), Essen (588 000), Dortmund (589 000), Stuttgart (591 000) und Düsseldorf (573 000). 3.2 Sprache Die deutsche Sprache mit ihren zahlreichen Mundarten gehört zu den indogermanischen Sprachen. In einigen Regionen Schleswig-Holsteins ist Dänisch Schulsprache; in der Lausitz lebt eine Sorbisch sprechende Minderheit. Das Friesische wird im Bereich der Nordseeküste heute wieder vermehrt gesprochen. 3.3 Religion Die Mehrzahl der Deutschen gehört den beiden christlichen Konfessionen an; etwa 26,7 Millionen sind katholisch (vor allem im Süden des Landes) und 26,3 Millionen protestantisch (2003). Daneben gibt es verschiedene kleinere, vornehmlich christlich ausgerichtete Glaubensgruppierungen, unter ihnen die orthodoxe Kirche mit rund 900 000 Angehörigen. Etwa 30 Prozent der Bevölkerung sind konfessionslos. Formal sind Kirche und Staat strikt getrennt; die großen christlichen Kirchen sind allerdings in den Selbstverwaltungsorganen zahlreicher gesellschaftlicher Einrichtungen, insbesondere in den sozialen und kulturellen Bereichen vertreten und genießen innere Autonomie. Der Staat übernimmt die Einziehung der Kirchensteuer. Durch den großen Anteil türkischer Arbeitnehmer und ihre Familien bilden die Muslime inzwischen eine große Glaubensgruppe: 3,3 Millionen Menschen bekannten sich 2003 zum Islam, von ihnen besaßen 310 000 die deutsche Staatsangehörigkeit. Die 83 jüdischen Gemeinden zählen etwa 100 000 Mitglieder. 3.3.1 Feiertage Gesetzliche Feiertage in Deutschland sind Neujahr (1. Januar), Ostern, der Tag der Arbeit (1. Mai), Pfingsten, Christi Himmelfahrt, Fronleichnam, der Tag der Deutschen Einheit (3. Oktober), Allerheiligen (1. November) und Weihnachten, das vom Heiligen Abend bis zum zweiten Weihnachtstag dauert. Daneben gibt es Festtage, die je nach Region variieren. Der Karneval bzw. die Fastnacht oder der Fasching werden besonders im Rheinland und in Süddeutschland, vor allem im schwäbisch-alemannischen Raum, gefeiert. 3.4 Soziales Deutschland versteht sich als Sozialstaat. Eine umfassende Sozialgesetzgebung soll gewährleisten, dass jeder Bürger ein menschenwürdiges Leben führen kann (z. B. durch Sozialhilfe) und ein gewisses Maß an Chancengleichheit herrscht (z. B. durch das Bundesausbildungsförderungsgesetz). Wichtigste Säule der sozialen Sicherung ist die gesetzliche Sozialversicherung, die auf fünf Säulen ruht: der Krankenversicherung, der Pflegeversicherung, der Rentenversicherung, der Arbeitslosenversicherung und der Unfallversicherung. Finanziert werden sie durch anteilige Beiträge der Arbeitnehmer und Arbeitgeber sowie durch Zuschüsse des Bundes. 4 BILDUNG UND KULTUR Die Kulturhoheit wird in der Bundesrepublik Deutschland von den Landesregierungen ausgeübt; sie sind für das Bildungssystem verantwortlich. Bildung, Wissenschaft und Kultur nahmen 2004 knapp 92 Milliarden Euro in Anspruch. Länderübergreifende Gremien wie die Kultusministerkonferenz stellen sicher, dass Schulsysteme und Anforderungen einander in zentralen Punkten entsprechen. 4.1 Bildungswesen In Deutschland besteht für Kinder und Jugendliche eine neunjährige allgemeine Schulpflicht; der Schulbesuch ist grundsätzlich kostenlos. Der (nicht verbindliche) Besuch eines Kindergartens ist ein ergänzendes pädagogisches Angebot zur sozialen und geistigen Vorbereitung auf den Schuleintritt - und im Übrigen eine deutsche Erfindung, die in vielen Ländern Nachahmung fand. Die Kinder besuchen ab dem festgelegten Einschulungsalter von in der Regel sechs Jahren zunächst vier Jahre lang die Grundschule. Nach Abschluss der Grundschule im Alter von etwa zehn Jahren gehen fast die Hälfte der Schüler fünf Jahre lang auf eine Hauptschule. Darauf folgt eine dreijährige Berufsausbildung, bestehend aus Lehre oder Praktikum und begleitendem Unterricht an einer Berufsschule. Circa ein Fünftel der Kinder besucht nach der Grundschule sechs Jahre lang eine Realschule mit Schwerpunkt auf kaufmännischen und berufsvorbereitenden Fächern. Nach der Realschule ist der zweijährige Besuch einer Fachoberschule möglich. Ungefähr einer von vier Schülern besucht nach der Grundschule ein Gymnasium; das dort zu erwerbende Abitur berechtigt zur Aufnahme eines Universitätsstudiums. In den siebziger Jahren eingeleitete Reformen haben die strenge Unterscheidung zwischen den drei Schultypen gelockert, so dass einige Schüler während der Ausbildung von einem Schultyp zum anderen wechseln können. Das ebenfalls in dieser Zeit entstandene Konzept der Gesamtschule vereinigt alle drei Ausbildungswege in einer jederzeit durchlässigen Struktur. Im Schuljahr 2004/05 besuchten rund 9,6 Millionen Schüler allgemein bildende Schulen. Eine lange Tradition hat das Hochschulwesen: die Heidelberger Ruprecht-Karls-Universität (gegründet 1386) gehört zu den ältesten Universitäten Europas. Andere führende Universitäten Deutschlands sind u. a. in Berlin, Bonn, Erlangen, Frankfurt am Main, Freiburg, Göttingen, Hamburg, Leipzig, Marburg an der Lahn, München und Tübingen ansässig. Außerdem gibt es in Deutschland zahlreiche pädagogische Hochschulen, Kunsthochschulen, Musik- und Filmhochschulen, theologische Seminare sowie die Fernuniversität Hagen. 2006 waren rund 1,98 Millionen Studierende an deutschen Hochschulen immatrikuliert, davon waren etwa 300 000 Studienanfänger. Am 1. August 1998 trat in Deutschland, Österreich und der Schweiz eine Rechtschreibreform in Kraft. Bereits im Vorfeld war es zu einer heftigen öffentlichen Kontroverse gekommen; Reformgegner konnten die vorgezogene Einführung der Reform in einzelnen Bundesländern durch Gerichtsentscheide stoppen. Eine weitere Rechtschreibreform, die manche Vorschriften der vorangegangenen Reform revidierte, trat zum 1. August 2006 in Kraft. 4.2 Kulturelle Einrichtungen Anders als in England und Frankreich, wo sich das geistige und kulturelle Leben überwiegend in London und Paris abspielt, gibt es in Deutschland traditionell viele solcher Zentren. Sie waren jahrhundertelang die Hauptstädte der zahlreichen deutschen Staaten, deren Herrscher Kunst, Musik, Theater und Gelehrsamkeit als Ausdruck ihrer Macht förderten. Berlin war von 1871 bis 1945 die kulturelle und politische Hauptstadt des geeinten Landes und hat diese Rolle seit 1990 wieder inne. Institutionen wie Museen, Bibliotheken, Opernhäuser, Theater und Orchester werden von den entsprechenden Städten oder Bundesländern subventioniert. Die Ausgaben der öffentlichen Haushalte für Kunst und Kulturpflege erreichten 1999 rund 15 Milliarden DM, darunter allein 6,4 Milliarden DM für Theater und Musik sowie etwa zwei Milliarden DM für Museen und Sammlungen. 4.3 Museen und Bibliotheken Im 2. Weltkrieg wurden viele Museen, Bibliotheken und historische Gebäude beschädigt oder zerstört, doch viele Kulturschätze blieben erhalten. Das wieder erwachte Interesse an der deutschen Geschichte vor dem 20. Jahrhundert führte zum Aufbau und zur Pflege alter Gebäude, die die Altstädte in vielen deutschen Städten neu belebten. Die herausragenden Kunstsammlungen der Könige von Preußen befinden sich in Berlin. Die Staatlichen Museen der Stiftung Preußischer Kulturbesitz beherbergen u. a. Sammlungen ägyptischer Kunst, Gemälde alter Meister und des 19. und 20. Jahrhunderts. Die Sammlungen der bayerischen Herrscher sind in den Bayerischen Staatsgemäldesammlungen in München (Alte Pinakothek, Neue Pinakothek) untergebracht. Das Bayerische Nationalmuseum in München enthält kunsthandwerkliche Exponate und Sammlungen der Volkskunst. Das Römisch-Germanische Museum in Köln stellt antike römische Funde aus. Ein führendes Museum im Osten Deutschlands sind die Staatlichen Kunstsammlungen in Dresden, früher im Besitz der Herrscher von Sachsen. Zu ihnen gehören eine weltberühmte Galerie alter Meister und eine schöne Porzellansammlung, beide im Zwinger, und die kunsthandwerkliche Sammlung im Grünen Gewölbe. Die Sammlungen mit antiker, nahöstlicher und islamischer Kunst der preußischen Könige gehören zu den Staatlichen Museen des ehemaligen Ostberlin. Weitere Kunstschätze befinden sich im Privatbesitz der Kirche oder adliger Familien. Bedeutende naturwissenschaftliche Sammlungen beherbergen das Naturmuseum Senckenberg in Frankfurt am Main (sehr viele Ausstellungsstücke stammen aus der Grube Messel bei Darmstadt), das Technische Museum in Dresden und das Deutsche Museum in München, eines der bedeutendsten technischen Museen der Welt. Die Städtischen Museen in Frankfurt beherbergen Kunst- und Volkskunstsammlungen und eine Auswahl archäologischer und historischer Exponate. Weitere bedeutende Museen sind das Wallraf-Richartz-Museum und das Museum Ludwig in Köln mit seiner bedeutenden Sammlung moderner Kunst sowie das Museum Fridericianum in Kassel, zentraler Austragungsort der documenta. Wichtige Forschungsbibliotheken sind die Bayerische Staatsbibliothek in München, die Deutsche Staatsbibliothek in Berlin und die Deutsche Bibliothek in Frankfurt am Main. Außerdem gibt es überall in Deutschland hervorragende Universitätsbibliotheken und zahlreiche städtische und kirchliche Leihbüchereien. 1995 gab es in Deutschland 3 982 Museen und 13 032 öffentliche Bibliotheken. 4.4 Theater und Musik Deutschland besitzt eine große Theater- und Konzerttradition. Herausragende Opernhäuser befinden sich in Berlin, Köln, Leipzig, Dresden, Hamburg, München und Stuttgart. Das Stuttgarter Ballett ist weltbekannt. Repertoiretheater, Freiluftbühnen und Kabaretts gibt es in vielen deutschen Städten; dazu gehört das Deutsche Theater in Berlin ebenso wie die Münchner Kammerspiele oder das Berliner Ensemble. Weltberühmt sind die Berliner, die Münchner und die Bamberger Symphoniker, das Gleiche gilt für die Rundfunkorchester von München, Köln und Hamburg. Internationale Besucher erscheinen in großer Zahl zu Festspielen wie den Bayreuther Wagner-Festspielen und den Bachfestivals in Ansbach und Leipzig. 1996 engagierten sich rund 2,5 Millionen Bundesbürger in Gesangsvereinen. 4.5 Literatur und Kunst Siehe deutsche Literatur; deutsche Kunst und Architektur 5 VERWALTUNG UND POLITIK Die staatliche Grundordnung wird durch die Verfassung der Bundesrepublik Deutschland, das Grundgesetz, festgelegt, das am 24. Mai 1949 in Kraft trat und im Lauf der Zeit mehrmals abgeändert bzw. ergänzt wurde. Das Grundgesetz definiert die Bundesrepublik Deutschland als ,,demokratischen und sozialen Bundesstaat". Staatsform ist die parlamentarische Demokratie mit ihrer deutlichen Gewaltenteilung (Exekutive, Legislative, Judikative) und einem ausgeprägten Parteiensystem. Mit der Wiedervereinigung am 3. Oktober 1990 wurde der Geltungsbereich des Grundgesetzes auf die neuen Bundesländer ausgedehnt. 5.1 Exekutive Staatsoberhaupt der Bundesrepublik Deutschland ist der Bundespräsident. Er wird von der Bundesversammlung, bestehend aus den Mitgliedern des Bundestages und einer gleichen Anzahl von Personen, die von den Länderparlamenten bestimmt werden, für eine Amtszeit von fünf Jahren gewählt. Der Bundespräsident schlägt den Bundeskanzler vor und ernennt ihn, nachdem er vom Bundestag mit absoluter Mehrheit gewählt wurde. Auf Vorschlag des Bundeskanzlers ernennt der Bundespräsident auch die Minister der Bundesregierung; außerdem fällt die Ernennung der Bundesrichter und der Offiziere in seine Zuständigkeit. Unter bestimmten Umständen kann der Bundespräsident den Bundestag auflösen. Die Bundesregierung ist als Exekutive dem Bundestag verantwortlich und kann Gesetzentwürfe zur Beratung und Verabschiedung einbringen (Gesetzesinitiative). 5.2 Legislative Das deutsche Parlament besteht aus zwei Kammern - dem Bundestag und dem Bundesrat. Die Mitglieder des Bundestages werden in allgemeinen Wahlen für eine Amtszeit von bis zu vier Jahren gewählt; wahlberechtigt sind alle Bürger ab 18 Jahren. Die Hälfte der Bundestagsabgeordneten werden als Direktkandidaten in den Wahlkreisen gewählt, die andere Hälfte nach den Grundsätzen der Verhältniswahl. Eine Partei kann nur dann in den Bundestag einziehen, wenn sie mindestens 5 Prozent der Wählerstimmen auf sich vereinigt oder wenigstens drei Direktmandate erringt (siehe Fünfprozentklausel). Die Mitglieder des Bundesrats, durch den das föderalistische System der Bundesrepublik seinen institutionellen Ausdruck findet, werden von den Länderregierungen benannt. Dabei bestimmt sich die Zahl der entsandten Ländervertreter (zwischen drei und sechs) nach der Einwohnerzahl des jeweiligen Landes. Gesetze werden im Allgemeinen durch einfache Mehrheit im Bundestag verabschiedet. In bestimmten Bereichen, vor allem wenn sie Länderkompetenzen betreffen, bedürfen Gesetze der Zustimmung des Bundesrats, in anderen kann der Bundestag dessen Widerspruch überwinden. In strittigen Fällen zustimmungspflichtiger Gesetzesvorhaben versucht der von Bundesrat und Bundestag paritätisch besetzte Vermittlungsausschuss eine annehmbare Lösung zu finden. Ein besonderes Gewicht gewinnt der Bundesrat, wenn in ihm das politische Lager die Stimmenmehrheit stellt, das im Bundestag die Opposition bildet. Die Möglichkeit, dass hierdurch wichtige politische Entscheidungen blockiert oder lange verzögert werden können, hat einen Reformbedarf der bundesstaatlichen Ordnung deutlich gemacht. 2006 wurde deshalb eine Föderalismusreform verabschiedet, durch die u. a. die Schwerfälligkeit und Unübersichtlichkeit im Gesetzgebungsverfahren überwunden wird. Bevor ein Gesetz in Kraft treten kann, muss es vom Bundespräsidenten, der sein rechtmäßiges Zustandekommen überprüft, unterzeichnet werden. Für Änderungen des Grundgesetzes ist eine Zweidrittelmehrheit von Bundestag und Bundesrat notwendig; bestimmte elementare Bestandteile des Grundgesetzes dürfen nicht geändert werden. In Deutschland gelten nicht nur Gesetze, die vom Bundestag und Bundesrat verabschiedet wurden. Denn im Interesse der europäischen Einigung hat der deutsche Gesetzgeber (gemäß Artikel 23 und 24 des Grundgesetzes) eine Reihe von Hoheitsrechten an die Europäische Union (EU) übertragen und sich dadurch selbst Einschränkungen auferlegt und anerkannt, dass EU-Recht dem nationalen Recht vorgeht. So sind nationale Gesetze ungültig, wenn sie Verordnungen der EU widersprechen. Und wenn die EU Richtlinien beschlossen hat, muss der nationale Gesetzgeber diese in nationales Recht umsetzen. Die Gewaltenteilung zwischen Legislative und Exekutive ist in der Bundesrepublik nicht vollkommen durchgeführt. So sind der Bundeskanzler und die Bundesminister auch Abgeordnete im Bundestag, und die Mitglieder des Bundesrats gehören den Länderregierungen an. 5.3 Judikative Im Unterschied zu den beiden anderen Gewalten ist die Rechtsprechung in Deutschland in der Tat völlig unabhängig. Richter sind allein dem Gesetz verpflichtet, an keine Weisungen gebunden und können - außer bei schweren Verfehlungen - nicht abgesetzt werden. Das höchste Gericht ist das Bundesverfassungsgericht mit Sitz in Karlsruhe. Es ist die höchste Instanz bei der Auslegung des Grundgesetzes. Daneben gibt es für die unterschiedlichen Zweige des Rechtswesens je eine eigene Gerichtsbarkeit, die in sechs weiteren Bundesgerichten gipfelt: dem Bundesgerichtshof, dem Bundesverwaltungsgericht, dem Bundesfinanzhof, dem Bundesarbeitsgericht, dem Bundessozialgericht und dem Bundespatentgericht. An der Spitze der Landgerichte eines jeden Bundeslandes steht das jeweilige Oberlandesgericht. Ein mehrstufiger Instanzenweg gewährleistet, dass die Rechtsprechung mehrmals überprüft werden kann. In der Zivil- und Strafgerichtsbarkeit können z. B. Amtsgericht, Landgericht, Oberlandesgericht, Bundesgerichtshof und - auf dem Weg der Verfassungsbeschwerde - Bundesverfassungsgericht zum Zuge kommen. Wie bei der Gesetzgebung werden auch in der Rechtsprechung die nationalen Schranken zunehmend überwunden. So können deutsche Bürger in bestimmten Fällen auch internationale Gerichte anrufen (z. B. den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte) oder von ihnen zur Rechenschaft gezogen werden (z. B. vom Internationalen Strafgerichtshof). 5.4 Verwaltungsgliederung Als föderaler Bundesstaat ist Deutschland in 16 Bundesländer gegliedert: Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, NordrheinWestfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein sowie Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Jedes Bundesland besitzt ein in allgemeinen Wahlen gewähltes Parlament, das einen Ministerpräsidenten oder Ersten Bürgermeister (Hamburg, Bremen und Berlin) als Vorsitzenden der Landesregierung bestimmt. Die Regierungen der Bundesländer verfügen über umfassende Kompetenzen, darunter das Recht, in gewissem Umfang Steuern zu erheben; außerdem fällt u. a. die Ausgestaltung der jeweils eigenen Bildungs- und Kulturpolitik und die Aufsicht über die Polizei in die Hoheit der Länder. Auf den Gebieten, die grundlegend den gesamten Staat betreffen - wie Außen-, Verteidigungs-, Währungs- und Zollpolitik -, hat jedoch der Bund die ausschließliche Gesetzgebungskompetenz. Bei sich überschneidenden Interessenlagen, in denen das Bedürfnis einer einheitlichen Regelung besteht, kann sich der Bund durch eine ,,konkurrierende Gesetzgebung" durchsetzen (,,Bundesrecht bricht Landesrecht"). Über die Institution des Bundesrats wirken die Länder zugleich maßgeblich an der Bundesgesetzgebung mit. Die Bundesländer sind in Regierungsbezirke (nur die größeren Bundesländer), Landkreise, kreisfreie Städte und Gemeinden gegliedert; alle Ebenen sind nach den Grundsätzen der parlamentarisch-demokratisch verfassten Selbstverwaltung organisiert. So besitzen alle Bundesländer eigene Parlamente, die den Ministerpräsidenten des Landes wählen, die Landesregierung kontrollieren und Landesgesetze verabschieden. Das alleinige Gesetzgebungsrecht haben die Länder u. a. in der Gestaltung der Länderverfassungen (die dem Grundgesetz nicht widersprechen dürfen) und ihrer Haushalte, im Kommunalrecht, im Polizei- und Ordnungsrecht sowie im Kulturbereich. Eigene Gerichte, darunter auch Landesverfassungsgerichte, gewährleisten den Rechtsfrieden. Um einheitliche Lebensbedingungen im gesamten Bundesgebiet herzustellen, erfolgt ein Finanzausgleich zwischen Bund, Ländern und Gemeinden. 5.5 Politische Parteien Die Parteien organisieren die politische Macht auf allen Ebenen der Gesellschaft. Nach dem Grundgesetz (Artikel 21) wirken sie an der Willensbildung mit. In der politischen Wirklichkeit sind sie jedoch zu deren Hauptträgern geworden, begrenzt oder kontrolliert allenfalls von den Medien, Interessenverbänden und anderen gesellschaftlichen Organisationen (z. B. Bürgerinitiative). Nach dem Demokratiegebot des Grundgesetzes müssen die Parteien demokratisch organisiert sein und dürfen keine verfassungsfeindlichen Ziele verfolgen. Das Parteiengesetz enthält die rechtlichen Grundlagen für die Arbeit der Parteien. Zu den wichtigsten Parteien in Deutschland gehören die Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD), die Christlich-Demokratische Union (CDU), die Christlich-Soziale Union (CSU), Bündnis 90/Die Grünen, die Freie Demokratische Partei (FDP) und Die Linke, die 2007 aus der Fusion der vor allem in den ostdeutschen Bundesländern starken Linkspartei und der im Westen verankerten WASG hervorging. Die CDU ist in Bayern nicht vertreten; dort ist stattdessen die eng mit ihr verbundene CSU aktiv. Beide Parteien, 1945 gegründet, bilden im Deutschen Bundestag eine Fraktionsgemeinschaft. Im Ahlener Programm der CDU wurden zunächst dezidiert sozialistische Grundsätze formuliert (betriebliche Mitbestimmung, Verstaatlichung von Schlüsselindustrien), nach 1947 setzten sich die konservativen Kräfte in der Partei durch. Die 1875 gegründete SPD vollzog 1959 mit ihrem Godesberger Programm die endgültige Abkehr von marxistischen Idealen und wandelte sich unter der Wertvorstellung des ,,Demokratischen Sozialismus" von der Klassenpartei zu einer in der modernen Bürgergesellschaft mehrheitsfähigen Volkspartei. Ausschlaggebend für die Mehrheitsverhältnisse im Bundestag war oft die 1948 gegründete, neoliberal orientierte FDP. Als Juniorpartner bildete sie zusammen mit CDU und CSU von 1949 bis 1953 und von 1961 bis 1966 christlichliberale Koalitionsregierungen, mit der SPD von 1969 bis 1982 sozialliberale. 1982 wechselte sie wieder die Seite und beteiligte sich bis 1998 erneut an einer CDU-geführten Regierung. Die aus den zahlreichen Bürgerbewegungen der achtziger Jahre sowie der Friedens- und Umweltbewegung hervorgegangene Partei Die Grünen zog 1983 erstmals in den Bundestag ein. 1990 vereinigte sie sich mit den ostdeutschen Grünen, und 1993 schloss sie sich mit der ostdeutschen Bürgerrechtspartei Bündnis 90 zu Bündnis 90/Die Grünen zusammen. Von 1998 bis 2005 bildete Bündnis 90/Die Grünen als Juniorpartner mit der SPD eine Koalitionsregierung. Nach dem Zusammenbruch der DDR 1989 bildete sich als Nachfolgeorganisation der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands (SED) die Partei des Demokratischen Sozialismus (PDS) heraus. Sie konnte sich in den neuen Bundesländern als Oppositionspartei profilieren und Wahlerfolge erzielen, und sie beteiligte sich auch an SPDgeführten Koalitionsregierungen (Mecklenburg-Vorpommern, Berlin). In Westdeutschland gelang es ihr dagegen nicht, Fuß zu fassen. 5.6 Verteidigung Im Zuge der Westintegration der Bundesrepublik wurde 1955 die Bundeswehr gegründet und in die Streitkräfte der NATO integriert. In der DDR bestand bis 1989 die Nationale Volksarmee (NVA), die ihrerseits in den Warschauer Pakt eingebunden war. Die Hauptaufgabe der Bundeswehr besteht nach Artikel 87a des Grundgesetzes in der militärischen Landesverteidigung. Nur im Fall des Notstands darf sie unter bestimmten Voraussetzungen auch im Innern militärisch eingesetzt werden. Seit Anfang der neunziger Jahre beteiligt sich die Bundeswehr an friedenssichernden Maßnahmen im Rahmen internationaler Missionen der Vereinten Nationen. Direkt an Kriegshandlungen beteiligt war sie erstmals im Luftkrieg der NATO gegen Jugoslawien im Kosovo-Konflikt 1999. Es besteht eine allgemeine Wehrpflicht. Wehrpflichtig sind alle Männer zwischen 18 und 28 Jahren, der Wehrdienst dauert seit dem 1. Januar 2002 neun Monate (vorher zehn Monate). Daneben gibt es die grundgesetzlich garantierte Möglichkeit, den Dienst mit der Waffe aus Gewissensgründen zu verweigern; anerkannte Kriegsdienstverweigerer sind zu einem Ersatzdienst verpflichtet, der in der Regel soziale Aufgaben in öffentlichen Einrichtungen umfasst (Zivildienst). Am 2. Januar 2001 traten erstmals in der Geschichte der Bundeswehr Frauen den - freiwilligen - Dienst mit der Waffe an. Vorher durften Frauen bei der Bundeswehr nur im Sanitäts- und Militärmusikdienst arbeiten. Im Dezember 2000 hatten Bundestag und Bundesrat die gesetzlichen Grundlagen für den gleichberechtigten Einsatz von Frauen in der Bundeswehr in allen Waffengattungen geschaffen. Das Ende des Ost-West-Konflikts änderte die Aufgabenstellung der Bundeswehr vollständig. Ihr bisheriges Rüstungsprogramm, ihre Struktur und ihre Truppenstärke, die ganz auf eine mögliche Konfrontation mit dem - nun nicht mehr existierenden - Warschauer Pakt ausgerichtet war, erwiesen sich als überholt. Die neue internationale Rolle Deutschlands stellte neue Anforderungen an die geostrategische Ausrichtung der Bundeswehr: Vergleichbar der außenpolitischen Rolle des Militärs anderer Mächte dient sie nun auch der Sicherung der Handlungsfähigkeit Deutschlands auf der Bühne der Weltpolitik. Seit 1994 stehen die deutschen Streitkräfte für bewaffnete Friedensmissionen bereit. Zudem gab die Bedrohung durch den internationalen Terrorismus seit 2001 Anlass, die Landesverteidigung faktisch aus den Grenzen des Landes und des NATOBündnisgebiets zu lösen (,,out of area"). Unterdessen sind deutsche Streitkräfte - ausgestattet mit internationalen Mandaten und im Rahmen von Missionen der Vereinten Nationen, NATO oder EU - mit rund 8 000 Soldaten auf drei Kontinenten militärisch aktiv, zur Bekämpfung des Terrorismus, zur Konfliktverhütung und zur Krisenbewältigung. Der Einsatz der Bundeswehr bedarf jeweils der Genehmigung durch den Deutschen Bundestag. Um die Bundeswehr zu einer global interventionsfähigen Einsatzarmee zu machen, wird sie in großem Umfang neu organisiert und technisch modernisiert, zugleich aber auch verkleinert. Anfang 1990 umfassten die deutschen Streitkräfte 475 000 Soldaten der Bundeswehr und 180 000 der Nationalen Volksarmee der DDR; 2005 betrug die Truppenstärke nur noch 257 000 Soldatinnen und Soldaten. 6 WIRTSCHAFT Mit der Wiedervereinigung von West- und Ostdeutschland im Oktober 1990 wurde auch der Zusammenschluss der beiden unterschiedlichen Wirtschaftssysteme (Planwirtschaft, soziale Marktwirtschaft) eingeleitet. Die erforderlichen Umstrukturierungen brachten zum Teil schmerzliche Prozesse in Gang. Allein der massive Stellenabbau im Zuge der Privatisierung ehemals staatseigener Betriebe hatte in den neuen Bundesländern eine stark anwachsende Arbeitslosigkeit zur Folge, ein Problem, das dort bis dahin nicht bekannt war. Weil die Eigentumsfrage für bestimmte Liegenschaften nicht geklärt war, kam es zur Verzögerung notwendiger privater Investitionen - in manchen Fällen blieben sie sogar ganz aus. Trotz einiger Anstrengungen (z. B. Transferzahlungen, Steuerbegünstigungen) ließ sich in den neuen Bundesländern ein wirtschaftlicher Aufschwung im erhofften Maß nicht verzeichnen. Vor allem auf dem Arbeitsmarkt bestehen zwischen den alten und den neuen Bundesländern große Unterschiede: Die Arbeitslosenquote ist in den neuen Bundesländern deutlich höher als in den alten Bundesländern. 1991 etwa betrug die Arbeitslosenquote im Jahresdurchschnitt in den alten Bundesländern 6,3 Prozent und in den neuen 10,3 Prozent (ganz Deutschland: 7,3 Prozent); in den folgenden Jahren erhöhten sich sowohl die Quoten als auch der Abstand zwischen Ost und West; in den neuen Bundesländern lag die Quote zeitweise bei mehr als 20 Prozent. 1997 erreichte die Arbeitslosenquote mit im Jahresdurchschnitt 12,7 Prozent (4,4 Millionen Arbeitslose) für das gesamte Bundesgebiet ihren bis dahin höchsten Stand. In den darauf folgenden Jahren sank die Quote zwar wieder, nämlich bis auf 10,3 Prozent 2001, stieg dann aber wieder kontinuierlich an. Im Januar 2005 waren erstmals seit Bestehen der Bundesrepublik mehr als fünf Millionen Menschen arbeitslos gemeldet; das entsprach einer Arbeitslosenquote von 12,1 Prozent. In der Folgezeit sank die Quote erneut, und zwar auf unter 10 Prozent Anfang 2007. Im Westen wie im Osten Deutschlands führten Rationalisierungsmaßnahmen zum Phänomen des Jobless Growth: Output und Unternehmensgewinne wachsen, ohne dass neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Die Gesamtzahl der Erwerbstätigen in Deutschland liegt bei etwa 41 Millionen. Davon sind 60 Prozent in Dienstleistungsunternehmen, 37 Prozent in der Industrie und 3 Prozent in der Landwirtschaft beschäftigt. Trotz der dramatischen Situation auf dem deutschen Arbeitsmarkt und der hohen Staatsverschuldung (2005: rund 1,4 Billionen Euro) gehört die Bundesrepublik nach wie vor zu den weltweit führenden Industrienationen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) beträgt 2 897 Milliarden US-Dollar (2006). Hiervon erwirtschaftet der Dienstleistungssektor 69,1 Prozent, das verarbeitende Gewerbe 22,70 Prozent, das Baugewerbe 3,60 Prozent und die Landwirtschaft 1 Prozent. Rechnerisch ergibt sich daraus ein BIP pro Kopf von 35 167 US-Dollar. 6.1 Landwirtschaft Die Mehrzahl der Bauernhöfe im Westen des Landes sind relativ klein; rund 75 Prozent haben eine Fläche von höchstens 20 Hektar. Sie werden von ihren Besitzern und deren Familien oft als Nebenerwerbsbetriebe bewirtschaftet. In der Landwirtschaft arbeiten rund 1,3 Millionen Menschen. Die gesamte landwirtschaftlich genutzte Fläche betrug 2005 circa 17 Millionen Hektar. Gut zwei Drittel der Fläche entfallen auf Ackerland, knapp ein Drittel auf Grünland. In den letzten Jahren stellten viele Betriebe wirtschaftlich erfolgreich auf eine biologisch-dynamische Produktionsweise um und schlossen sich zum Teil alternativen Vermarktungsorganisationen an. Die besten Anbaugebiete befinden sich am Südrand des Norddeutschen Tieflands. Angebaut werden hauptsächlich Zuckerrüben, Kartoffeln, Gerste, Weizen, Hafer und Roggen, Mais und Raps. In einigen klimatisch begünstigten Gebieten wird in Sonderkulturen Wein angebaut. Namhafte Anbaugebiete liegen u. a. in Franken, in Rheinhessen, an der Mosel und am Kaiserstuhl. Große Bestände an Rindern, Schweinen, Schafen und Geflügel werden zunehmend in spezialisierten Betrieben gezüchtet. Deutschland nimmt in der EU den ersten Rangplatz als Milcherzeugerland sowie hinsichtlich der Produktion von Schweinefleisch ein. 89 Prozent des Nahrungsbedarfs können in Deutschland durch einheimische Produkte gedeckt werden. 6.2 Forstwirtschaft und Fischerei Forstwirtschaft und Fischerei spielen in Deutschland eine beträchtliche Rolle. Bei der Aufforstung wurden schnell wachsende Nadelhölzer bevorzugt; heute bemüht man sich allerdings, die Anteile der ökologisch wertvolleren Laubhölzer zu erhöhen. Die wirtschaftlich bedeutendsten Ressourcen befinden sich in den großen Wäldern im Südwesten; über 70 Prozent davon sind Nadelholz. Der seit den achtziger Jahren bekannte saure Regen verursachte zum Teil gravierende Waldschäden, welche die Existenzgrundlage der Forstwirtschaft lang- oder mittelfristig massiv bedrohen. Die wichtigsten Fischereihäfen des Landes sind Bremen, Bremerhaven und Cuxhaven an der Nordsee und Kiel an der Ostsee. Die Fangmenge beläuft sich auf durchschnittlich 330 353 Tonnen (2005), der überwiegende Anteil davon sind verschiedene Seefische, besonders Heringe. 6.3 Bergbau Deutschland verfügt über verschiedene Bodenschätze. Steinkohle wird u. a. zur Energieerzeugung und zur Herstellung von Eisen und Stahl eingesetzt. Sie lagert vor allem in den Revieren des Ruhrgebiets und des Saarlands. Allerdings sind die Fördermengen im Lauf der Zeit stark zurückgegangen: Während 1987 noch rund 82 Millionen Tonnen Steinkohle pro Jahr gefördert wurden, waren es 1997 nur noch 47 Millionen Tonnen und 2006 lediglich 21 Millionen Tonnen. Ein Grund für die sinkende Nachfrage nach Steinkohle ist der billigere Energieträger Erdöl. Nach UN-Schätzungen verfügt Deutschland über die fünftgrößten Braunkohlereserven der Welt. Sie wird z. B. im rheinischen Revier (Köln/Aachen), in der Lausitz und im mitteldeutschen Revier (Halle/Leipzig) im großen Maßstab abgebaut. Allerdings wurden auch bei der Braunkohle die Fördermengen im Lauf der Zeit zum Teil stark reduziert. Hintergrund hierfür sind u. a. die erheblichen Umweltbelastungen, die sowohl die Verbrennung (zur Energiegewinnung) als auch der Braunkohleabbau selbst mit sich bringen. Reiche Vorkommen an Kalisalzen gibt es vor allem im Südwesten um Freiburg, Steinsalzlagerstätten finden sich in Niedersachsen sowie in Bayern. Bescheidene Erdöl- und Erdgasvorkommen gibt es im Norden in der Nähe der Mündungen von Ems und Weser sowie östlich von Kiel. Deutschland besitzt darüber hinaus vergleichsweise kleine Lagerstätten an Blei- und Zinkerzen. 6.4 Industrie Ein wichtiger Bereich der deutschen Wirtschaft ist die exportorientierte Industrie mit einer Vielzahl von Produkten. Hergestellt werden vor allem Nahrungsmittel, Maschinen, chemische und elektrotechnische Erzeugnisse und Kraftfahrzeuge. In den alten Bundesländern konzentrieren sich große industrielle Unternehmen in verschiedenen Wirtschaftszentren. Der größte Industriestandort liegt in Nordrhein-Westfalen. Zu ihm gehören das Stahl produzierende Ruhrgebiet und weitere große Industriebezirke wie Aachen, Köln und Düsseldorf mit chemischer Industrie, Metallverarbeitung und Maschinen- und Kraftfahrzeugbau. Eine andere große Industrieregion liegt am Zusammenfluss von Rhein und Main. Zu ihr gehören die Städte Frankfurt, Wiesbaden, Mainz und Offenbach mit Metall verarbeitender Industrie, chemischer, pharmazeutischer, Elektro- und Automobilindustrie. Südlich davon erstreckt sich entlang des Rheins ein bedeutender Industriebezirk mit den Zentren Mannheim, Ludwigshafen und Karlsruhe mit chemischer Industrie, Maschinenbau und Baumaterialien. Stuttgart ist der Mittelpunkt einer Region mit Fahrzeug- und Maschinenbau sowie Elektro-, Textil- und optischer Industrie. In der Münchner Region sind Flugzeug-, Automobil-, Rüstungs- und Bekleidungsindustrie, Genussmittelindustrie und zahlreiche Verlagshäuser beheimatet. Weitere Industriegebiete liegen im Nordwesten und Norden Deutschlands. Zu ihnen gehört die Region Hannover-Braunschweig mit Stahl-, Automobil- und chemischer Industrie sowie die Seehäfen Hamburg, Bremen, Bremerhaven, Wilhelmshaven, Lübeck und Kiel, die als Umschlagplätze für nationale und internationale Wirtschaftsgüter zahlreichen Industrien (z. B. Erdölraffinerien, Nahrungsmittel, Schiffbau) als Standort dienen. In Wolfsburg befindet sich mit dem Volkswagenwerk der bedeutendste deutsche Automobilhersteller. Die alten Industriestandorte in den neuen Bundesländern stellen mit ihrer immensen Umweltverschmutzung und industriell bedingten Altlasten ein großes Problem dar. So wurden beispielsweise schon kurz nach der Wiedervereinigung zahlreiche Betriebe aufgrund ihrer Umweltverschmutzung stillgelegt. Bedeutende Industriezentren befinden sich vor allem in den Bundesländern Berlin (Elektrotechnik), Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und im südlichen Brandenburg. Viele chemische Fabriken sind in der Region von Dessau, Halle und Leipzig (Schkopau, Bitterfeld-Wolfen, Leuna) konzentriert. Eine große petrochemische Anlage in Schwedt an der Oder im Nordosten Deutschlands verarbeitet Erdöl, das über Pipelines aus Russland kommt. In zahlreichen Städten im Südwesten, vor allem in Sachsen, wird die Industrie durch den Maschinenbau geprägt. Zentren des Fahrzeugbaus sind die Städte Eisenach, Zwickau, Suhl und Ludwigsfelde. Optische Instrumente und Präzisionsgeräte werden in Jena und Görlitz hergestellt. Jena ist ein wichtiger Standort der Glasindustrie. In Rostock (Warnemünde), in Wismar und in Stralsund gibt es Werften. 6.5 Währung und Bankwesen Währungseinheit ist seit dem 1. Januar 2002 der Euro zu 100 Cents, der die Deutsche Mark (DM) zu 100 Pfennigen als alleiniges Zahlungsmittel ablöste. Noten- und Zentralbank der Bundesrepublik ist die Deutsche Bundesbank, ein von der Regierung unabhängiges Institut mit Sitz in Frankfurt am Main. Die größten der zahlreichen privaten Banken Deutschlands sind Aktiengesellschaften, so z. B. die Deutsche Bank, die Dresdner Bank und die Commerzbank. Daneben gibt es viele Sparkassen und kleinere private Kreditinstitute. Die Europäische Zentralbank (EZB) mit Sitz in Frankfurt am Main löste im Juni 1998 ihren Vorläufer, das Europäische Währungsinstitut (EWI), ab. Die EZB bildet zusammen mit den nationalen Zentralbanken - für die Bundesrepublik die Deutsche Bundesbank - das Europäische System der Zentralbanken (ESZB). Die Hauptaufgabe dieser Institution besteht darin, die Preisstabilität in den Mitgliedsstaaten der Europäischen Währungsunion zu gewährleisten. 6.6 Außenhandel Deutschland ist eines der führenden Exportländer. Seit den fünfziger Jahren übertrifft der Erlös aus Warenexporten die Ausgaben für Importe in der Regel weit. Die wichtigsten deutschen Exportartikel sind Maschinen, Automobile, chemische Erzeugnisse, Eisen, Stahl, Textilien und Kleider. Importiert werden vor allem Rohöl und Erdölprodukte, Maschinenteile, Nahrungsmittel, chemische Erzeugnisse und Zwischenprodukte, Kleider und Fahrzeuge. Deutschland ist ein wichtiger Handelspartner der Länder der Europäischen Union sowie der Europäischen Freihandelsassoziation ( European Free Trade Association, EFTA), der Vereinigten Staaten, der Schweiz, der mittelund osteuropäischen Staaten und des asiatischen Raumes - hier vor allem Japan. 6.7 Verkehrswesen Deutschland besitzt ein hoch entwickeltes Verkehrssystem mit einem außergewöhnlich dichten Netz von Straßen und insbesondere Autobahnen. Das gesamte Straßennetz umfasst 231 581 Kilometer (2003). Im Jahr 2004 waren in Deutschland etwa 45,4 Millionen Personenkraftwagen zugelassen. Das Schienennetz der 1994 aus der Deutschen Bundesbahn und der Deutschen Reichsbahn hervorgegangenen privatrechtlichen Deutschen Bahn AG hat eine Gesamtlänge von etwa 34 228 Kilometern (2005). Neben dem Personenverkehr kommt dem Gütertransport traditionell eine wichtige Rolle zu. Angesichts des dichten Straßennetzes werden jedoch tendenziell immer mehr Güter mit Lastwagen transportiert. Verbundsysteme in Form von Container-Terminals oder der ,,Rollenden Landstraße" (einem Huckepack-Verfahren für Schwerlastwagen) versuchen dem entgegenzusteuern. Neuartige Hochgeschwindigkeitszüge wie der ICE verkürzen in Verbindung mit neuen (teils ökologisch umstrittenen) Trassenführungen die Fahrzeiten im Personenverkehr auf langen Strecken erheblich und treten so teilweise in Konkurrenz zum Flugzeug. Von nach wie vor großer Bedeutung für den internationalen Güterverkehr ist trotz der langen Transportzeiten die Schifffahrt. Die Heimathäfen der deutschen Handelsflotte sind Hamburg, Wilhelmshaven, Bremen, Nordenham und Emden für die Nordsee und Lübeck, Wismar, Rostock und Stralsund für die Ostsee. Der größte Seehafen ist Hamburg. Die größte Binnenwasserstraße bildet der Rhein. Weitere Binnenschifffahrtswege mit hohem Güterverkehr sind u. a. Mosel, Main und Elbe. An Kanälen sind beispielsweise der Nord-Ostsee-Kanal, der Mittellandkanal, der Dortmund-Ems-Kanal, der Elbe-Havel-Kanal und der Main-Donau-Kanal zu nennen. Der wichtigste und größte Binnenhafen ist Duisburg. Der Rhein-Main-Flughafen in Frankfurt ist der größte Flughafen Deutschlands; daneben gibt es noch weitere Großflughäfen, so z. B. in München, Berlin, Düsseldorf und Hamburg. Größte deutsche Fluggesellschaft ist die Deutsche Lufthansa AG, die zahlreiche Ziele im In- und Ausland anfliegt. 6.8 Energie 62,5 Prozent des Gesamtbedarfs Deutschlands an elektrischem Strom deckten 2003 Wärmekraftwerke. Hier werden in erster Linie Erdöl und Erdgas verfeuert. 28,1 Prozent der gesamten elektrischen Energie erzeugen Kernkraftwerke (siehe Kernenergie). Im Süden tragen Wasserkraftwerke an den großen Flüssen mit 3,7 Prozent zur Stromversorgung bei. Deutschland fördert zwar auch selbst Erdöl und Erdgas, importiert aber den größten Teil seines Bedarfs an diesen Energieträgern. Deutschland ist weltweit führend bei der Stromgewinnung aus Windkraft, auch wenn die absolute Menge der durch Wind erzeugten Energie noch gering ist. Am 11. Juni 2001 unterzeichneten Vertreter der Bundesregierung und der Energiewirtschaft eine Vereinbarung zum allmählichen Ausstieg aus der Kernenergie in Deutschland. Danach sollen die 19 in Betrieb befindlichen Kernkraftwerke innerhalb von 20 Jahren schrittweise vom Netz genommen werden. 7 GESCHICHTE Zur deutschen Geschichte und zur Geschichte der DDR siehe deutsche Geschichte, Besatzungszeit in Deutschland und Deutsche Demokratische Republik. Nach der Wahl zum ersten Deutschen Bundestag vom 14. September 1949 bildete Konrad Adenauer eine Koalitionsregierung aus CDU, CSU, FDP und DP. Theodor Heuss wurde zum Bundespräsidenten gewählt. Während die SPD im Wahlkampf Planwirtschaft und Sozialisierung der Grundstoffindustrien gefordert hatte, leitete die Regierung Adenauer unter Wirtschaftsminister Ludwig Erhard eine Politik der sozialen Marktwirtschaft ein. Sie ermöglichte die wirtschaftliche Eingliederung der Vertriebenen und trug der CDU/CSU in den Bundestagswahlen von 1953 und 1957 hohe Stimmgewinne ein. Eine selbständige Außenpolitik ermöglichten die Revision des Besatzungsstatuts (1951) und das Petersberger Abkommen vom November 1949, das die Errichtung konsularischer Vertretungen im Ausland und die Beteiligung der Bundesrepublik Deutschland an internationalen Organisationen gestattete. 1951 unterzeichnete die Bundesregierung den Vertrag über die Montanunion. 7.1 Die Westintegration Die von den USA gewünschte und von Adenauer angebotene Beteiligung der Bundesrepublik an der Verteidigung Westeuropas und damit die Aufstellung von westdeutschen Streitkräften führte zu scharfen innenpolitischen Auseinandersetzungen. 1952 wurde dennoch der Vertrag über die Europäische Verteidigungsgemeinschaft (EVG) zusammen mit dem Deutschlandvertrag unterzeichnet. Nachdem die französische Nationalversammlung 1954 den EVG-Vertrag abgelehnt hatte, wurde das Problem des deutschen Verteidigungsbeitrags durch die Schaffung der Westeuropäischen Union gelöst. Zugleich erhielt die Bundesrepublik erweiterte Souveränitätsrechte, und es erfolgte ihre Aufnahme in den Nordatlantikpakt (NATO). Mit In-Kraft-Treten der 1954 unterzeichneten Pariser Verträge am 5. Mai 1955 wurde das Besatzungsstatut gegenstandslos; die Bundesrepublik Deutschland erhielt damit die weitgehende, allerdings durch einige alliierte Vorbehalte eingeschränkte Souveränität. Die wirtschaftliche Integration der Bundesrepublik in den Westen erhielt mit der in den Römischen Verträgen (1957) beschlossenen Schaffung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) und der Europäischen Atomgemeinschaft (EURATOM) neuen Auftrieb. 7.2 Das Verhältnis zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Sowjetunion Das Verhältnis der Bundesrepublik Deutschland zur Sowjetunion und den Staaten des Ostblocks war durch die kontroverse Haltung in der Deutschlandfrage bestimmt. Die Angebote Stalins von 1952 (siehe Stalinnote), ein wieder vereinigtes, neutralisiertes Deutschland zuzugestehen und auch über freie, gesamtdeutsche Wahlen diskutieren zu wollen, fielen direkt in die Endphase der Verhandlungen über den EVG- und Deutschlandvertrag im Anschluss an die erfolgreich verlaufene Londoner Außenministerkonferenz (17.-19. Februar 1952). Die Westmächte, die in Stalins Vorstoß nur eine taktische Variante sowjetischen Vormachtstrebens in Deutschland und Europa sahen, waren nicht bereit, die inzwischen fortgeschrittene Integration Westdeutschlands in das westliche Bündnis rückgängig zu machen und die Bundesrepublik zugunsten eines neutralen Deutschlands aufzugeben. Sie bestanden auf international kontrollierten Wahlen als Prämisse für die Bildung einer frei gewählten deutschen Regierung. Auch Adenauer vermutete, dass Stalin mit seinen Verhandlungsangeboten die erfolgreich begonnene Einigung Westeuropas behindern und die USA aus Europa verdrängen wollte. Er hielt es daher, im Unterschied zu Politikern der SPD, FDP und der eigenen Partei, in dieser Situation für ungünstig, über die sowjetische Offerte zu verhandeln, zumal die unter alliierter Vormundschaft stehende Bundesrepublik keine Mitsprachemöglichkeit besaß. Der Tod Stalins am 5. März 1953 weckte Hoffnungen auf eine Entspannung der Lage in Europa, vor allem weil nach Ende des Koreakrieges mit dem Indochinakrieg neue Komplikationen in der Weltpolitik entstanden waren. Die gewaltsame Niederschlagung des Volksaufstands in Ostberlin und verschiedenen Orten der DDR am 17. Juni 1953 durch die Rote Armee schien allerdings das Sicherheitsdenken der Bundesregierung zu bestätigen und führte zu einem großen Wahlerfolg der CDU bei der Bundestagswahl im September 1953. Als Antwort auf die Pariser Verträge und die damit erfolgte Einbindung der Bundesrepublik in das westliche Militärbündnis schlossen sich Mitte Mai 1955 acht Staaten des Ostblocks zu einem Militärbündnis unter der Führung Moskaus - dem Warschauer Pakt - zusammen. Ihm wurden 1956 auch die inzwischen geschaffenen Streitkräfte der Nationalen Volksarmee eingegliedert. Die Sowjetunion ging nun von der Existenz zweier völkerrechtlich getrennter deutscher Staaten aus, die die Deutschlandfrage künftig in eigener Verantwortung zu lösen hatten. Der Versuch Adenauers, Moskau von dieser Theorie abzubringen, gelang nicht. Immerhin aber konnte er die Freilassung der letzten knapp 10 000 deutschen Kriegsgefangenen sowie circa 20 000 Zivilinternierter aus der Sowjetunion erreichen und damit einen großen persönlichen Erfolg verbuchen. Als Gegenleistung musste der Kanzler der von Moskau geforderten Aufnahme diplomatischer Beziehungen zustimmen und den Alleinvertretungsanspruch der Bundesrepublik aufgeben. Um zu verhindern, dass künftig auch andere Staaten außerhalb des Warschauer Paktes diplomatische Beziehungen zu Ostberlin aufnahmen, wurde im Bonner Auswärtigen Amt die nach dem Außenminister benannte Hallsteindoktrin entwickelt, die jede Aufnahme diplomatischer Beziehungen mit der DDR als ,,unfreundlichen Akt" gegenüber der Bundesrepublik betrachtete und mit dem Abbruch der Beziehungen beantwortete. Als Druckmittel galt die erstarkte westdeutsche Wirtschaft und die mit dem Aufbau der Bundeswehr erreichte militärische Gleichberechtigung. 7.3 Parteienverbote Im Interesse der im Grundgesetz verankerten ,,wehrhaften Demokratie" bestätigte das Bundesverfassungsgericht das Verbot zweier verfassungswidriger Parteien: 1952 wurde die 1949 gegründete neonazistische Sozialistische Reichspartei (SRP) und 1956 die Kommunistische Partei Deutschlands (KPD) verboten. Andere kleine Parteien verloren in den folgenden Jahren immer mehr an Stimmen. 7.4 Das Godesberger Programm der SPD Die SPD konnte nach dem Tod ihres Vorsitzenden Kurt Schumacher (1952) mit dem Godesberger Programm von 1959 ihre innenpolitische Stellung verbessern. Die Partei löste sich von marxistischen Programmteilen, ohne ihren Anspruch auf einen demokratischen Sozialismus aufzugeben. 7.5 Der Mauerbau Mit der Errichtung der Mauer in Berlin durch die DDR am 13. August 1961 war jede Hoffnung auf eine Wiedervereinigung zerstört. Noch während des über Nacht begonnenen Baus kam es zu dramatischen Fluchtaktionen, teils sogar aus den Fenstern von Häusern, die sich genau auf der Grenze befanden. Die Berliner Mauer wurde zum Symbol des Eisernen Vorhangs zwischen Ost und West; der Versuch ihrer Überwindung kostete zahlreiche Menschen das Leben. In den folgenden Jahrzehnten baute die DDR ihre Staatsgrenze zur Bundesrepublik zu einem beinahe unüberwindlichen ,,Todesstreifen" mit Stacheldraht, Minen, Selbstschussanlagen und scharfen Wachhunden aus. Dennoch kam es immer wieder zu spektakulären, aber auch tragisch endenden Fluchtversuchen. Zur Unterbindung der strafbaren Republikflucht erließ die DDRFührung schon bald einen Schießbefehl an die Grenzsoldaten. Adenauer, der befürchtet hatte, dass sein sofortiges Erscheinen in der nun geteilten Stadt zu unkontrollierten Aufständen - besonders im Ostteil - führen würde, kam erst am 22. August 1961 nach Berlin. Dies kostete ihn und seine Partei in den folgenden Bundestagswahlen vom 17. September 1961 zahlreiche Stimmen. Zunehmende Differenzen mit seinen Ministern und seiner Partei führten am 15. Oktober 1963 zu seinem Rücktritt. Sein Nachfolger im Amt wurde Ludwig Erhard. Mit seiner bisherigen Tätigkeit als Wirtschaftsminister hatte sich das so genannte Wirtschaftswunder verbunden, der rasche wirtschaftliche Aufschwung mit Vollbeschäftigung, dessen Grundlagen jedoch bereits durch den amerikanischen Marshallplan gelegt worden waren. Die von Erhard geführte Koalitionsregierung aus Unionsparteien und FDP wurde nach den Wahlen von 1965 erneuert. Mit der Friedensnote vom 25. März 1966, die das Angebot des gegenseitigen Gewaltverzichts beinhaltete, wagten Kanzler Erhard und sein Außenminister Gerhard Schröder einen ersten Schritt in Richtung auf einen Abbau der Konfrontation mit der DDR und eine Ausrichtung der deutschen Außenpolitik auf die Gegebenheiten der deutschen Spaltung. Dagegen gelang es der Regierung nicht, die wachsende wirtschaftliche Rezession zu beheben und die u. a. dadurch entstandene Unruhe im Land zu beruhigen. 7.6 Von der großen Koalition zur sozialliberalen Regierung Am 1. Dezember 1966 bildete Kurt Georg Kiesinger (CDU) eine große Koalition aus CDU/CSU und SPD, die u. a. eine wirtschaftliche Neuorientierung einleitete. Die Tatsache einer großen Koalition verstärkte die Proteste der Jugend, besonders der Studenten, die seit Anfang der sechziger Jahre kritisch mit der nationalsozialistischen Vergangenheit ins Gericht gegangen war und die, beeinflusst durch die neomarxistische Frankfurter Schule, nach grundlegenden Reformen in Staat und Gesellschaft rief. Zahlreiche, zum Teil gewalttätige Demonstrationen in den westdeutschen Großstädten und die Bildung einer außerparlamentarischen Opposition (APO) waren die Folge. Nach jahrelangen Auseinandersetzungen wurde 1968, gegen heftigen Widerstand insbesondere der Gewerkschaften und gegen die Stimmen der FDP und von 50 Bundestagsabgeordneten der SPD, eine Notstandsverfassung mit Vorschriften für den ,,Verteidigungsfall", für Spannungssituationen und für Katastrophenfälle beschlossen. 7.7 Entwicklung zu einer entspannten Ostpolitik 1969 wurde Gustav Heinemann (SPD) zum Bundespräsidenten gewählt. Gewinner der Bundestagswahl vom 28. September 1969 wurde die SPD. Zusammen mit der FDP bildete sie unter Bundeskanzler Willy Brandt die neue Regierung, die antrat, eine neue Politik, vor allem im Verhältnis zur DDR, zu entwickeln. Die Staatlichkeit der DDR im Rahmen der deutschen Nation wurde akzeptiert und der Versuch unternommen, mit ihren Führern ins Gespräch zu kommen. Durch Unterzeichnung des deutschsowjetischen Moskauer Vertrags über gegenseitigen Gewaltverzicht und des deutsch-polnischen Warschauer Vertrags (beide 1970) über die Anerkennung der bestehenden polnischen Westgrenze an der Oder-Neiße-Linie (unter Vorbehalt) sowie den Abschluss des Berlinabkommens (1971) leitete Brandt eine neue Deutschland- und Ostpolitik ein. Es folgten 1972 der Verkehrsvertrag und der Grundlagenvertrag, der die Beziehungen der beiden deutschen Staaten zueinander auf eine vertragsmäßige Basis stellen sollte. Die Auseinandersetzungen um die vor allem von der CDU bekämpften Ostverträge bestimmten von 1970 bis 1973 die innenpolitische Diskussion. Durch ein konstruktives Misstrauensvotum versuchte die CDU/CSU-Opposition am 27. April 1972 vergeblich, Brandt zu stürzen. Durch das Überwechseln von Abgeordneten der FDP und der SPD zur Opposition verlor die Regierung zwar Sitze, gewann dann aber in der vorgezogenen Bundestagswahl 1972, und die SPD wurde stärkste Fraktion im Bundestag. Am 18. September 1973 wurden die Bundesrepublik und die DDR in die Vereinten Nationen (UNO) aufgenommen. Die Auswirkungen der durch den Jom-Kippur-Krieg vom Oktober 1973 verursachten Ölkrise und der beschleunigten Inflation, große tarifpolitische Zugeständnisse der Regierung, innerparteiliche Kämpfe in der SPD und Spannungen mit dem Koalitionspartner, u. a. verursacht durch die Mitbestimmungsfrage, schwächten die Stellung Brandts. Dagegen konnte die CDU/CSU bei verschiedenen Landtagswahlen seit 1973 an politischem Terrain zugewinnen. Nach der Enttarnung des DDR-Spions Günther Guillaume (siehe Guillaume-Affäre) im Bundeskanzleramt trat Brandt am 7. Mai 1974 zurück. Kurz zuvor, am 2. Mai, hatten die Ständigen Vertretungen der beiden deutschen Staaten in Bonn und Ostberlin ihre Arbeit aufgenommen. Akkreditiert wurden am 20. Juni für die Bundesrepublik Günter Gaus und für die DDR Michael Kohl. Die DDR sagte im Gegenzug Verbesserungen im Besucher- und Reiseverkehr zu. 7.8 Bundeskanzler Helmut Schmidt Am 15. Mai 1974 wählte die Bundesversammlung den FDP-Vorsitzenden Walter Scheel zum vierten Bundespräsidenten und einen Tag später der Bundestag Finanzminister Helmut Schmidt (SPD) zum neuen Bundeskanzler. Seinem Kabinett gehörten elf SPD- und vier FDP-Minister an. Am 1. August 1975 endete nach zweijährigen Beratungen in Genf und Helsinki die Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE) mit der Unterzeichnung der Schlussakte durch Repräsentanten von 35 Staaten Europas - unter ihnen beide deutsche Staaten. In der Folge wurde u. a. ein Renten- und Kreditabkommen mit Polen abgeschlossen und die Ausreise von 125 000 Deutschstämmigen in die Bundesrepublik in den kommenden vier Jahren vereinbart. Im November 1975 verabschiedete die SPD auf dem Mannheimer Parteitag einen ökonomisch-politischen Orientierungsrahmen als Langzeitprogramm bis 1985, das, vom Godesberger Programm ausgehend, die Grundwerte des demokratischen Sozialismus präzisierte. Bei der achten Bundestagswahl vom 3. Oktober 1976 wurde die CDU/CSU wieder stärkste Fraktion, doch behauptete die sozialliberale Koalition knapp die Mehrheit. 7.8.1 Organisierter Terrorismus Ein Hauptproblem der Innenpolitik in der zweiten Hälfte der siebziger Jahre ergab sich aus dem Auftreten des bewaffneten Terrorismus in Form der Baader-Meinhof-Gruppe und ihrer Nachfolgeorganisation Rote-Armee-Fraktion (RAF) mit mehreren Attentaten auf Politiker und einflussreiche Repräsentanten der Wirtschaft sowie der Diskussion um die Methoden der strafrechtlichen Verfolgung (Kontaktsperregesetz, Verteidigerausschluss). Im Juni 1978 musste Innenminister Werner Maihofer (FDP) wegen Fahndungspannen im Entführungsfall Schleyer und des umstrittenen ,,Lauschangriffs" auf den der Kontakte zur Terrorszene verdächtigten Atomwissenschaftler Klaus Traube zurücktreten. Sein Nachfolger wurde Gerhard Baum (FDP). 7.8.2 Die Beziehungen zur DDR Anfang der achtziger Jahre Am 1. Juli 1979 übernahm Carl Carstens (CDU) das Amt des Bundespräsidenten. Trotz zunehmender Verhandlungsaktivitäten zwischen beiden deutschen Staaten und angeblich expandierender DDR-Wirtschaft nahmen DDR-Bürger nach wie vor große Risiken auf sich, um in die Bundesrepublik zu flüchten. Mitte September 1979 gelang acht DDR-Bürgern die Flucht mit einem Heißluftballon. Im August 1980 gab die Zentrale Erfassungsstelle der deutschen Länderjustizverwaltung bekannt, dass seit dem 13. August 1961, dem Tag des Baus der Mauer in Berlin, 25 000 Fälle von Gewaltanwendung und Übergriffen von DDR-Organen registriert und 177 Menschen an der Mauer ums Leben gekommen waren. Ebenfalls im September 1979 befürwortete die Synode des Bundes der Evangelischen Kirche der DDR in Dessau den baldigen Zusammenschluss der Landeskirchen. Die Beziehungen zur DDR wurden auf verschiedenen Ebenen ausgebaut. Im März 1980 beschlossen die Jungsozialisten in der SPD (Vorsitzender Gerhard Schröder), ihre Beziehungen zur Freien Deutschen Jugend (FDJ) zu vertiefen, und bei einem Gespräch mit Bundeskanzler Schmidt im April erklärte Günter Mittag, Mitglied des Politbüros und ranghöchster Wirtschaftspolitiker der DDR, seine Regierung wünsche einen systematischen Ausbau der Wirtschaftsbeziehungen mit der Bundesrepublik. Außerdem wurde zur Verbesserung des Berlinverkehrs ein Abkommen unterzeichnet, nach dem sich die Bundesrepublik mit 507 Millionen DM an den Kosten beteiligen sollte. Aus Anlass des Tages der Deutschen Einheit am 17. Juni 1980 betonte Kanzler Schmidt die Vordringlichkeit des Friedens; die deutsche Einheit sei nicht erzwingbar. Das brachte ihm die Rüge der Opposition ein, er betrachte die deutsche Frage nur als Pflichtübung. Bei den Wahlen zum neunten Bundestag am 5. Oktober 1980 konnte Helmut Schmidt mit der sozialliberalen Koalition seine Mehrheit ausbauen. Gegenkandidat der Unionsparteien war Franz Josef Strauß (CSU). Die CDU/CSU blieb stärkste Fraktion im Bundestag, obwohl sie 4,1 Prozentpunkte eingebüßt hatte. Als ihr Vorsitzender wurde für weitere vier Jahre Helmut Kohl wieder gewählt. Schmidt bekannte sich erneut zur NATO, EG und zur Partnerschaft mit den USA als Grundlagen westlicher Sicherheit. Ebenso plädierte er für den Erhalt und Ausbau der Beziehungen zur DDR wie auch zu den osteuropäischen Staaten. Zur Aufrechterhaltung des militärischen Gleichgewichts befürwortete er Rüstungskontrolle statt -wettlauf. Sicherung der Energieversorgung, Intensivierung des Wohnungsbaus und Integration der Ausländer waren weitere Ziele seiner Politik. Am 9. Oktober 1980 (vier Tage nach der Bundestagswahl) erhöhte die DDR die Mindestumtauschsätze für Westbesucher von 13 DM auf 24 DM pro Tag. Wenige Tage später forderte SED-Generalsekretär Erich Honecker die Anerkennung der DDR-Staatsbürgerschaft durch die Bundesrepublik sowie die Umwandlung der Ständigen Vertretungen beider Staaten in Botschaften. Die Bundesregierung protestierte gegen die Erhöhung des Zwangsumtausches, der die Besucherzahlen stark zurückgehen ließ. 7.8.3 Der NATO-Doppelbeschluss In der Folge SPD-interner Differenzen - insbesondere um den NATO-Doppelbeschluss von 1979 - drohte Kanzler Schmidt im Mai 1981 mit seinem Rücktritt, falls sich die Partei in ihrer Mehrheit gegen den Beschluss von 1979 aussprechen sollte. Seiner Einschätzung nach musste das angesichts der internationalen Situation unabsehbare Konsequenzen für das westliche Bündnis haben. Zusammen mit US-Präsident Ronald Reagan betonte er während einer USA-Reise, dass Abschreckung und Rüstungskontrolle integrale Bestandteile des Bündnisses seien. Auf dem Sonderparteitag der SPD am 21. Juni wurde dann, trotz heftiger Kritik, mehrheitlich für den Nachrüstungsbeschluss gestimmt. Allerdings sprachen sich die Jungsozialisten eine Woche später ausdrücklich gegen den Beschluss, gegen Kernkraft und für die Verstaatlichung der Schlüsselindustrien aus. Im Anschluss an eine bei den Unionsparteien wie auch der US-Regierung auf harte Ablehnung gestoßenen Reise des SPDVorsitzenden Brandt nach Moskau erläuterte dieser die sowjetischen Vorschläge für eine Einfrierung der Zahl der Mittelstreckenraketen und Aufnahme von Abrüstungsverhandlungen mit den USA. Die Bundesregierung stimmte verhalten zu. Am 11. Juni 1981 wählte das Berliner Abgeordnetenhaus Richard von Weizsäcker zum Regierenden Bürgermeister der Stadt Berlin. Am 13. August bezeichnete dieser die 20 Jahre zuvor errichtete Berliner Mauer als ein ,,Symbol der Trennung", das viele Opfer gefordert hätte. Am 28. September wurde der DDR-Spion Guillaume durch den Bundespräsidenten begnadigt und im Rahmen einer Austauschaktion in die DDR gebracht. Anfang Dezember reiste Schmidt zu Gesprächen mit Erich Honecker an den Werbellinsee. Dabei erneuerte die DDR ihren Anspruch auf eine eigene Staatsbürgerschaft; der zinslose Kredit der Bundesrepublik für die DDR wurde erhöht und verlängert. Ab Oktober desselben Jahres kam es im Zusammenhang mit dem Bau der Startbahn West des Frankfurter Flughafens zu schweren Ausschreitungen, in deren Verlauf auch für Frieden und Abrüstung und gegen den NATO-Doppelbeschluss demonstriert wurde. 7.9 Bundeskanzler Helmut Kohl Die seit Sommer 1982 virulente Koalitionskrise zwischen SPD und FDP verschärfte sich im September aus Anlass eines von Bundeswirtschaftsminister Otto Graf Lambsdorff vorgelegten ,,Strategiepapiers". Am 17. September traten die vier FDP-Minister Baum, Ertl, Genscher und Lambsdorff zurück, nachdem Bundeskanzler Helmut Schmidt die Koalition mit der FDP aufgekündigt hatte, und die SPD regierte mit einem Minderheitskabinett weiter. Am 1. Oktober 1982 brachten die CDU/CSU- und die FDP-Fraktion den Antrag auf ein konstruktives Misstrauensvotum gegen Bundeskanzler Schmidt im Bundestag ein. Aus der Abstimmung ging der Führer der Opposition, Helmut Kohl, mit 223 Stimmen der Union und 33 der FDP als neuer Bundeskanzler hervor. Zahlreiche Delegierte des FDP-Bundeskongresses am 1. November 1982 traten infolge der Ereignisse aus der Partei aus. Wie zuvor abgesprochen, verweigerten auch die Abgeordneten der neuen Regierungsparteien dem Kanzler ihre Vertrauensbezeugung (am 17. Dezember 1982). Damit war der Weg frei für die Auflösung des Bundestages durch den Bundespräsidenten (7. Januar 1983), der gleichzeitig die Neuwahlen für März anberaumte. Aus den Bundestagswahlen vom 6. März 1983 gingen die Unionsparteien gestärkt, die FDP dagegen geschwächt hervor. Hans-Jochen Vogel wurde, als Nachfolger von Herbert Wehner, SPD-Fraktionsvorsitzender und Oppositionsführer im Bundestag. Am 23. Mai 1984 wählte die achte Bundesversammlung Richard von Weizsäcker zum sechsten Bundespräsidenten, der am 1. Juli sein Amt antrat. Er hielt am 8. Mai 1985 eine weltweit beachtete Rede anlässlich des ,,Tages der Befreiung von dem menschenverachtenden System der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft". 7.9.1 Die Innen- und Außenpolitik der Regierung Kohl bis 1989 Anfang Juli 1985 handelten Bonn und Ostberlin erneut eine Erhöhung des Überziehungskredits der DDR von 600 auf 850 Millionen DM für weitere fünf Jahre aus. Gleichzeitig sorgte die DDR - wohl als Reaktion auf die Festnahmen bzw. Enttarnungen verschiedener DDR-Spione in der Bundesrepublik - für einen Ausbau der Kontaktsperren, um so eine weitere Abgrenzung der Deutschen in beiden Staaten zu erreichen. Am 9. Dezember 1986 verzeichnete der Bundesminister für innerdeutsche Beziehungen Heinrich Windelen eine ,,gute Bilanz" der Kontakte: Mehrere innerdeutsche Städtepartnerschaften wurden abgeschlossen, der Reiseverkehr hatte einen Höchststand erreicht, und im März 1987 nahmen erstmals Bundeswehroffiziere als Beobachter an Manövern der Warschauer-Pakt-Staaten teil. Die Bundestagswahl vom 25. Januar 1987 brachte erneut eine Bestätigung der Bonner Regierungskoalition, obwohl die Union starke Verluste hinnehmen musste. Während die FDP zulegte, verlor die SPD Stimmen. Am 23. März 1987 erklärte der langjährige SPD-Vorsitzende Brandt in der Folge innerparteilicher Kritik wegen der Berufung einer neuen SPD-Sprecherin seinen Rücktritt (Nachfolger wurde am 14. Juni Hans-Jochen Vogel). Mit dem Besuch des israelischen Staatspräsidenten Chaim Herzog in der Bundesrepublik Anfang April 1987 betrat erstmals ein Staatsoberhaupt Israels deutschen Boden. Am 1. Juni einigte sich die Bonner Koalition über die Zustimmung zu einer erweiterten amerikanisch-sowjetischen Null-Lösung bei Mittelstreckenraketen. Anfang September 1988 begann der Abzug der amerikanischen Pershing-II-Raketen aus der Bundesrepublik auf dem Stützpunkt Waldheide bei Heilbronn. Die Jahresbilanz 1987 zeigte außerdem deutlich, dass trotz zunehmender Reise- und Kulturaktivitäten nach beiden Seiten auch die Zahl der Flüchtlinge und der Übersiedler in die Bundesrepublik laufend angestiegen war. Am 1. November 1987 traten zudem die von Honecker in Bonn zugesagten Reise- und Paketzusicherungen in Kraft. Einen Tag zuvor hatten die drei westlichen Stadtkommandanten Schüsse von DDR-Wachtposten auf Flüchtlinge als ,,grobe Missachtung grundlegender Menschenrechte" verurteilt. Am 9. November verständigten sich Vertreter beider deutscher Staaten auf rund 100 Vorhaben der kulturellen Zusammenarbeit im Rahmen des Kulturabkommens von 1986. 1988 registrierten die Aufnahmelager in der Bundesrepublik über 200 000 Aussiedler aus Osteuropa. Knapp 40 000 Zuwanderer kamen aus der DDR (1987: rund 19 000). Im Januar 1989 verurteilte Honecker ,,extremistische Ausfälle gegen die DDR" auf der KSZE-Folgekonferenz in Wien. In den folgenden Monaten ereigneten sich mehrere spektakuläre, zum Teil tödlich endende Fluchtversuche von DDR-Bürgern, was zu Protesten der Bundesregierung und der drei westlichen Alliierten sowie zu Absagen von Besuchen von Politikern auf verschiedenen Ebenen führte. Im April installierten DDR-Soldaten zusätzliche Signaldrähte an der innerdeutschen Grenze. Bei einem Besuch in Bonn Mitte des Monats bekannte sich der sowjetische Staats- und Parteichef Michail Gorbatschow für die UdSSR erstmals zum Selbstbestimmungsrecht der Völker und zum Schutz von Minderheiten. Zur Berliner Mauer sagte er, diese könnte auch wieder verschwinden, wenn die Voraussetzungen wegfielen, die sie hervorgebracht hätten. 7.9.2 Schritte zur Wiedervereinigung Im August 1989 spitzte sich die Flüchtlingsbewegung aus der DDR dramatisch zu; 55 970 DDR-Bürger waren zwischen Januar und Juli 1989 bereits in die Bundesrepublik gekommen, davon 46 634 mit Ausreisegenehmigung. Hunderte Menschen hatten sich in die diplomatischen Missionen der Bundesrepublik in Ostberlin, Budapest und Prag geflüchtet. Eine Lösung des Problems wurde dadurch erschwert, dass die DDR-Führung den Ausreisewilligen nur noch Straffreiheit zusicherte, aber keine Ausreisezusagen mehr machte. Nach Öffnung der österreichisch-ungarischen Grenze durch Ungarn reisten innerhalb von drei Tagen 15 000 Bürger der DDR aus. Sonderausreisegenehmigungen am 1. und 4. Oktober durch die DDR-Regierung (am 5. Oktober begannen die großen Feierlichkeiten zum 40. Jahrestag der DDR-Gründung) hatten die Flucht von mehreren tausend Ausreisewilligen über Prag, Warschau und aus Dresden zur Folge. Anlässlich seines Besuchs in Ostberlin mahnte der sowjetische Partei- und Staatschef Gorbatschow die Notwendigkeit von Reformen in der DDR an. In Leipzig demonstrierten bei Friedensgebeten Tausende (am 23. Oktober circa 300 000) für Reformen in der DDR ( siehe Montagsdemonstrationen). Am 26. Oktober telefonierte Kohl mit dem neuen Partei- und Staatschef der DDR, Egon Krenz (Honecker hatte am 18. Oktober alle Ämter niedergelegt), über die Fortsetzung der Zusammenarbeit, am 9. November öffnete die DDR alle Grenzen, und noch in derselben Nacht eilten Tausende in den Westen. Am 7. Dezember begannen die Gespräche zwischen DDR-Regierung und Opposition am runden Tisch in Ostberlin. Die Botschafter Großbritanniens, Frankreichs und der USA in der Bundesrepublik sowie der sowjetische Botschafter in der DDR trafen sich am 11. Dezember zu Gesprächen in Berlin; Kohl fuhr am 19. Dezember zum Ministerratsvorsitzenden Modrow nach Dresden, und sie beschlossen die Bildung einer Vertragsgemeinschaft. Die erste deutsch-deutsche Bankenbeteiligung wurde am 17. Januar 1990 vereinbart; gleichzeitig trafen sich die ranghöchsten Offiziere der Bundeswehr und der Nationalen Volksarmee (NVA); am 23. Januar trat die deutschdeutsche Wirtschaftskommission zusammen; am 1. Februar legte Modrow eine ,,Erklärung über den Weg zur deutschen Einheit vor", deren ,,Konzept deutscher Neutralität" der Bundeskanzler allerdings strikt ablehnte; im Anschluss an einen Besuch in Bonn vermeldete Modrow die Weichenstellung für die ,,baldige Vereinigung von DDR und BRD zu einem deutschen Bundesstaat"; am 18. März erkannten die Mitgliedsstaaten des Warschauer Paktes in Prag das Recht beider deutscher Staaten auf Einheit an. Am 20. März verständigten sich die Regierungsparteien in Bonn auf einen ,,Fahrplan zur deutschen Einheit". Ende April begannen DDR-Grenzsoldaten mit dem Abbruch der Berliner Mauer. Am 10. Mai setzte der Bundestag den Ausschuss ,,Deutsche Einheit" ein, eine Woche später einigten sich Bund und Länder auf einen ,,Kreditfonds Deutsche Einheit", und am 18. Mai unterzeichneten Bundesfinanzminister Waigel und sein DDR-Kollege Romberg im Bonner Palais Schaumburg den Staatsvertrag zur Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion, die am 1. Juli in Kraft trat (Kernbestimmung: die D-Mark wurde ab diesem Datum offizielles Zahlungsmittel in der DDR). Anfang August kündigte Bundesverteidigungsminister Stoltenberg die Bildung einer gesamtdeutschen Armee mit 320 000 Bundeswehr- und 50 000 NVA-Soldaten an. 7.9.3 Die Wiedervereinigung Am 23. August beschloss die DDR-Volkskammer den ,,Beitritt der DDR zur Bundesrepublik zum 3. Oktober 1990 gemäß Art. 23 des Grundgesetzes". Am 12. September unterzeichneten die Außenminister der beiden deutschen Staaten sowie Frankreichs, Englands, der USA und der Sowjetunion in Moskau den Zwei-plus-Vier-Vertrag, in dem die äußeren Aspekte der Herstellung der deutschen Einheit einschließlich der Fragen der Sicherheit der Nachbarstaaten geregelt und dem vereinten Deutschland nach 45 Jahren die volle Souveränität zuerkannt wurde. Er trat nach der Ratifizierung durch die Parlamente der vier Alliierten im Frühjahr 1991 in Kraft. Mit der Verabschiedung der westalliierten Stadtkommandanten am 2. Oktober 1990 war der Besatzungsstatus Berlins beendet. Am selben Tag trat die Volkskammer zum letzten Mal zusammen und löste sich ebenso auf wie die NVA. Am 20. September hatten Bundestag und Volkskammer mit der erforderlichen Zweidrittelmehrheit den Einigungsvertrag über den Beitritt der DDR sowie die rechtlichen und sozialen Fragen im zusammenwachsenden Deutschland endgültig verabschiedet, der am 29. September rechtskräftig wurde. Weitere wichtige Etappen in der Entwicklung Deutschlands nach dem 3. Oktober waren der deutsch-sowjetische Stationierungsvertrag (12. Oktober), der den Abzug der rund 380 000 Sowjetsoldaten und ihrer 220 000 Angehörigen festlegte, die Eingliederung der ehemaligen DDR in die EG (22. Oktober), der von Kohl und Gorbatschow unterzeichnete deutsch-sowjetische Vertrag über gute Nachbarschaft, Partnerschaft und Zusammenarbeit (9. November) und der DeutschPolnische Grenzvertrag (14. November). Aus der ersten gesamtdeutschen Bundestagswahl am 2. Dezember 1990 ging die CDU/CSU/FDP-Regierungskoalition mit 54,8 Prozent als Sieger hervor - auch in Berlin wurde am selben Tag die CDU stärkste Partei. Am 17. Januar 1991 trat Helmut Kohl erneut die Bundeskanzlerschaft an. 7.9.4 Aufarbeitung des DDR-Unrechts Am 30. November 1990 erließ das Amtsgericht Berlin-Tiergarten Haftbefehl gegen Honecker wegen gemeinschaftlich begangenen Totschlags (,,Schießbefehl"). Wegen seines akut verschlechterten Gesundheitszustands und der ungeklärten Rechtslage wurde der unter sowjetischer Obhut stehende ehemalige DDR-Chef aber nicht ausgeliefert. Verschiedene RAF-Terroristen, die im Zuge der Wiedervereinigung in der DDR aufgespürt worden waren, weil sie seit Ende der siebziger Jahre mit Hilfe des Ministeriums für Staatssicherheit (Stasi) hier Unterschlupf und Unterstützung gefunden hatten, wurden zu hohen Strafen verurteilt. Gegen den ehemaligen Stasi-Chef Mielke und einige seiner Mitarbeiter wurde Ende März Haftbefehl erlassen. 7.9.5 Folgen der deutschen Einheit In der Folgezeit wurden gemäß dem Einigungsvertrag zahlreiche Beschäftigte des öffentlichen Dienstes der DDR - vor allem auch der Universitäten - entlassen. Unmut in Ostdeutschland weckte darüber hinaus eine Regelung, nach der zur Gewinnung westdeutschen Personals für die ostdeutsche Verwaltung Westbeamte uneingeschränkt nach Westniveau besoldet wurden und ihre Verwendungszeit im Osten für das Ruhegeld doppelt zählen sollte. Gegen verschiedene Machthaber der ehemaligen DDR wurden wegen der Todesschüsse an der Mauer, der Veruntreuung von Geldern und anderer Delikte Haftbefehl erlassen (siehe Politbüro-Prozess). Das Wirtschaftssystem der DDR wurde abgeschafft und marktwirtschaftliche Verhältnisse eingeführt. Nach anfänglicher Euphorie machte sich in der Bevölkerung eine deutliche Ernüchterung breit, zumal viele erstmals die Erfahrung der Arbeitslosigkeit machten. In der Bevölkerung setzte ein sozialer Differenzierungsprozess ein, der ,,Vereinigungsgewinner und -verlierer" trennte. Am 20. Juni 1991 beschloss der Bundestag die Verlegung des Sitzes von Bundesregierung und Bundesrat nach Berlin. Die Berliner Treuhandanstalt verkaufte bis Ende Juni 2 583 Unternehmen aus ehemaligem DDR-Staatsbesitz für insgesamt 10,6 Milliarden DM. Im September 1991 häuften sich Anschläge Rechtsradikaler auf Asylbewerberheime; insgesamt stieg, besonders in den neuen Bundesländern, die Zahl fremdenfeindlicher Straftaten. 7.9.6 Das vereinte Deutschland Die folgenden Jahre waren gekennzeichnet durch die Diskussionen um die Haltung der Bundesrepublik angesichts des Krieges im ehemaligen Jugoslawien und um den Einsatz der Bundeswehr außerhalb des NATO-Gebietes sowie die Verabschiedung des Vertrags von Maastricht über die Europäische Union. Rechtsradikale Ausschreitungen nahmen weiter zu, in mehreren Prozessen gegen ehemalige Repräsentanten der DDR (Markus Wolf, Erich Mielke u. a.) sowie gegen informelle Mitarbeiter der Stasi und Mauerschützen (Mauerschützenprozesse) wurde das DDR-Erbe juristisch aufgearbeitet; die Arbeitslosigkeit stieg an, gleichzeitig aber kam es in den neuen Bundesländern zu einem raschen wirtschaftlichen Aufschwung. Am 23. Mai 1994 wurde der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Roman Herzog, als Nachfolger Richard von Weizsäckers zum neuen Bundespräsidenten gewählt. Die Wirtschaftsverträge mit ehemaligen Ostblockstaaten wurden angekurbelt, die Kurdenproblematik trat durch gewalttätige Auseinandersetzungen zwischen verschiedenen Kurdenorganisationen auf deutschem Boden deutlich zum Vorschein, und in der Asylbewerber-, Flüchtlings- und Aussiedlerproblematik wurde mit wechselndem Erfolg nach Lösungen gesucht (siehe Asylrecht). Bei der Wahl zum 13. Bundestag im Oktober 1994 konnte sich die Regierungskoalition behaupten. Ende des Jahres 1994 stellte die Treuhandanstalt ihre Tätigkeit ein. Im Mai 1995 jährte sich zum 50. Mal das Ende des 2. Weltkrieges sowie der nationalsozialistischen Herrschaft. In der Deutsch-Tschechischen Erklärung vom 20. Dezember 1996 bekannte sich die Bundesrepublik ,,zur Verantwortung Deutschlands für seine Rolle in einer historischen Entwicklung, die zum Münchner Abkommen von 1938, der Flucht und Vertreibung von Menschen aus dem tschechoslowakischen Grenzgebiet sowie zur Zerschlagung und Besetzung der Tschechoslowakischen Republik geführt hat". Im Gegenzug bedauerte die tschechische Regierung erstmals offiziell die Vertreibung der Sudetendeutschen und ,,insbesondere die Exzesse, die im Widerspruch zu elementaren humanitären Grundsätzen und auch den damals geltenden rechtlichen Grundsätzen gestanden haben". Im Umfeld der schließlich von beiden Regierungen unterzeichneten Erklärung kam es in beiden Ländern zu erheblichen Kontroversen. 1997 standen die hohe Arbeitslosigkeit, die sich verschärfende Rentenkrise, Kontroversen um eine Steuerreform und die so genannten ,,Kosten der Einheit" im Mittelpunkt der politischen Diskussion. Im Zusammenhang mit Atommülltransporten (Castor-Transporte) nach Gorleben kam es zum größten Polizeieinsatz der Nachkriegsgeschichte sowie zu heftigen Auseinandersetzungen mit Atomkraftgegnern. Im August 1997 wurden die ehemaligen DDR-Politbüromitglieder Egon Krenz, Günter Schabowski und Günther Kleiber zu sechseinhalb (Krenz) bzw. jeweils drei Jahren Haft verurteilt. Regierungskoalition und SPD einigten sich auf die Einführung des so genannten großen Lauschangriffs, der der Polizei das Abhören von Privatwohnungen erlaubt. Im September 1997 billigte der deutsche Bundestag den Vertrag von Amsterdam, der eine Reform und Erweiterung der EU vorsieht. Im Februar 1998 gab es in der Bundesrepublik Deutschland über 4,8 Millionen Arbeitslose; das war der bisherige Höchststand in der deutschen Nachkriegsgeschichte. Die Arbeitslosenquote für das gesamte Bundesgebiet lag im Februar bei 12,6 Prozent. Am 1. April 1998 wurden die systematischen Kontrollen im Personenverkehr an den Grenzen zwischen Deutschland, Österreich und Italien aufgehoben. Damit haben die drei Länder die Vereinbarung des Schengener Abkommens umgesetzt, das u. a. den ungehinderten Reiseverkehr zwischen den Unterzeichnerstaaten vorsieht. Deutschland hatte das Abkommen 1990 zunächst mit Frankreich und den Beneluxstaaten geschlossen, Italien trat 1992 und Österreich 1995 bei. Der Erfolg der rechtsradikalen DVU bei der Landtagswahl am 26. April 1998 in Sachsen-Anhalt löste eine bundesweite Diskussion über das Protest- und Nichtwählerverhalten und eine Debatte über den Rechtsradikalismus aus. Mit 12,9 Prozent der Stimmen hatte die DVU das beste Ergebnis einer rechtsradikalen Partei in Deutschland nach dem 2. Weltkrieg erzielt. Der durch die Wahlergebnisse in seinem Amt bestätigte Ministerpräsident Reinhard Höppner (SPD) bildete wieder eine von der PDS tolerierte Minderheitsregierung. Diese Tolerierung durch die PDS führte erneut zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen den großen Parteien über die Koalitionsfähigkeit der PDS: CDU und FDP lehnten eine Zusammenarbeit mit der PDS strikt ab, SPD und Grüne zeigten sich zu partieller Zusammenarbeit bereit. In der Praxis allerdings kooperierte aber auch die CDU zumindest auf kommunaler Ebene schon seit längerem mit der PDS. Im April 1998 stimmte der Deutsche Bundestag mit großer Mehrheit für die Teilnahme der Bundesrepublik an der dritten und letzten Stufe der Europäischen Wirtschaftsund Währungsunion, an der nach dem wenig später gefassten Beschluss des Europäischen Rates ab dem 1. Januar 1999 neben Deutschland die EU-Mitglieder Frankreich, Spanien, Portugal, Italien, Belgien, Luxemburg, die Niederlande, Österreich, Irland und Finnland teilnehmen sollten. 7.10 Bundeskanzler Gerhard Schröder (1998-2005) 7.10.1 Regierungswechsel Innenpolitisch stand das Frühjahr 1998 bereits im Zeichen des Wahlkampfes zur Neuwahl des Deutschen Bundestags am 27. September. Die SPD nominierte den niedersächsischen Ministerpräsidenten Gerhard Schröder als Kandidaten für das Amt des Bundeskanzlers. Unter dem Eindruck von Schröders Wahlsieg bei der Landtagswahl in Niedersachsen am 1. März 1998 hatte der SPD-Vorsitzende Oskar Lafontaine eigene Ambitionen auf die Kanzlerschaft zurückgestellt und Schröder den Vortritt gelassen. Vor dem Hintergrund einer unverändert hohen Arbeitslosigkeit (11,1 Prozent), innenpolitischer Stagnation und verbreiteter ,,Kanzlermüdigkeit" nach 16 Jahren KohlRegierung wurde 1998 erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik ein amtierender Bundeskanzler durch das Volk abgewählt. Die Wahlen zum 14. Deutschen Bundestag gewann die SPD: Sie erhielt 40,9 Prozent der Stimmen (gegenüber 36,4 Prozent 1994) und zog mit 298 Abgeordneten in den neuen Bundestag ein. Die CDU/CSU kam auf 35,2 Prozent (245 Sitze) und erzielte mit einem Minus von 6,2 Prozentpunkten ihr schlechtestes Ergebnis bei einer Bundestagswahl seit 1949. Bündnis 90/Die Grünen behauptete sich - trotz eines leichten Verlustes von 0,6 Prozentpunkten gegenüber 1994 - mit einem Stimmenanteil von 6,7 Prozent und 47 Bundestagssitzen als drittstärkste politische Kraft. Die FDP verlor 0,7 Prozentpunkte und zog mit 6,2 Prozent der Stimmen und 43 Abgeordneten wieder in den Bundestag ein. Nach 29 Jahren ununterbrochener Regierungsbeteiligung fand sich die FDP nun in der Oppositionsrolle wieder. Die PDS übersprang mit 5,1 Prozent die Fünfprozentklausel und war nun mit 36 Abgeordneten (darunter vier Direktmandate) erstmals in Fraktionsstärke im Bundestag präsent. In den neuen Bundesländern hatte sie 19,5 Prozent der Stimmen erhalten, in den westlichen dagegen nur gut 1 Prozent. Ausgestattet mit einer komfortablen Mehrheit im Bundestag vereinbarten SPD und Bündnis 90/Die Grünen eine Koalition. Am 27. Oktober 1998 wurde Gerhard Schröder als siebter Bundeskanzler seit 1949 vereidigt. Vizekanzler und Außenminister wurde Joschka Fischer (Bündnis 90/Die Grünen). Seine Partei besetzte in der neuen Regierung drei von 15 Ressorts. Nach mehreren für sie erfolgreichen Wahlen zu den Landtagen in den Bundesländern verfügten die Parteien der neuen Regierungskoalition zunächst auch über eine klare Mehrheit im Bundesrat und in der Bundesversammlung. Am 24. Mai 1999 wählte diese den SPD-Kandidaten und ehemaligen Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen, Johannes Rau, zum Bundespräsidenten. Rau wurde am 1. Juli 1999 als achtes Staatsoberhaupt der Bundesrepublik vereidigt, als letztes noch in der bisherigen Bundeshauptstadt Bonn. 7.10.2 Überblick Die ersten vier Jahre der rotgrünen Koalitionsregierung waren innenpolitisch von zahlreichen Reformvorhaben geprägt, die teilweise jedoch heftig umstritten und schwer umsetzbar waren. Angesichts eines ausbleibenden kräftigen Konjunkturaufschwungs scheiterte die Bundesregierung mit ihren Bemühungen, die hohe Arbeitslosigkeit auf ein erträgliches Maß zurückzuführen. In der Folge verlor die Koalition an Rückhalt in der Bevölkerung; in mehreren Bundesländern fiel nach Landtagswahlen die Regierungsmacht oder -beteiligung wieder an das konservativ-liberale Lager, so dass die rotgrüne Koalition schon seit Frühjahr 1999 nicht mehr über eine eigene Mehrheit im Bundesrat verfügte; ihre Reformpolitik konnte von der Opposition blockiert werden. Vor allem in den neuen Bundesländern machte sich Enttäuschung breit, die sich auch in Ausländerfeindlichkeit und rechtsextremistischen Aktivitäten äußerte. Auf dem internationalen Parkett spielte Deutschland eine zunehmend wichtige Rolle. SPD und Grüne sorgten trotz heftiger interner Auseinandersetzungen im KosovoKonflikt (1999) für die erstmalige Beteiligung deutscher Streitkräfte nach dem 2. Weltkrieg an Kampfhandlungen gegen einen anderen Staat. Nach den Terrorangriffen in den USA am 11. September 2001 waren die Innen- und Außenpolitik stark von den Bemühungen bestimmt, an der Seite der USA der Bedrohung durch den Terrorismus entgegenzuwirken. Das militärische Engagement Deutschlands in dem von den USA angeführten ,,Antiterrorkrieg", der sich zunächst auf die Beseitigung des Taliban-Regimes in Afghanistan bezog, zeigte die Notwendigkeit auf, auch die Bundeswehr in Organisation, Personalstärke und Rüstungstechnik den Erfordernissen einer ,,asymmetrischen Kriegsführung" anzupassen. In der letzten Phase des von Personalisierung gekennzeichneten Wahlkampfes vor der Bundestagswahl am 22. September 2002, in dem sich der amtierende Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) und der bayerische Ministerpräsident Edmund Stoiber (CSU) gegenüberstanden, gelang es den Parteien der Regierungskoalition überraschend, den für sie seit Monaten negativen Trend umzukehren. Als ausschlaggebend hierfür galten die entschlossenen Reaktionen Schröders auf die Herausforderungen, die sich ihm mit der Flutkatastrophe im August 2002 in Ostdeutschland und der Bereitschaft des amerikanischen Präsidenten zu einem Irak-Krieg stellten. Gegenüber der Bundestagswahl von 1998 büßte die SPD 2,4 Prozentpunkte ein, behauptete sich aber mit 38,5 Prozent knapp als stärkste politische Kraft vor CDU/CSU, die zusammen unter einem Zugewinn von 3,4 Prozentpunkten gleichfalls auf 38,5 Prozent kamen. Durch ein Plus von 1,9 Prozentpunkten erreichte Bündnis 90/Die Grünen 8,6 Prozent und rettete die Möglichkeit, die Koalition mit der SPD zu erneuern. Die FDP kam auf 7,4 Prozent (ein Plus von 1,1 Prozentpunkten); die PDS scheiterte mit einem Stimmenanteil von 4,0 Prozent (ein Minus von 1,1 Prozentpunkten) am Einzug in den Bundestag in Fraktionsstärke, allerdings gewannen zwei Politikerinnen ein Direktmandat. In den neuen Bundestag, der durch eine Neuabgrenzung der Wahlkreise um 29 auf 598 reguläre Sitze verkleinert worden war, zogen 251 Abgeordnete der SPD ein (einschließlich vier Überhangmandate), 248 von CDU/CSU (ein Überhangmandat), 55 Grüne, 47 der FDP und zwei der PDS. Die Fraktionen von SPD und Grünen verfügten zusammen über 306 Stimmen. Die Regierungsmehrheit im 15. Deutschen Bundestag lag bei 302 Stimmen. In ihrer zweiten Amtszeit sah sich die erneuerte rotgrüne Regierungskoalition mit einer weiteren Verschärfung der wirtschaftlichen und sozialen Probleme konfrontiert: Die schon lange andauernde wirtschaftliche Stagnation ging 2003 in eine Rezession über (das Bruttoinlandsprodukt schrumpfte um 0,1 Prozent), die nachfolgende Erholung mit einem Wirtschaftswachstum im Jahr 2004 um 1,7 Prozent blieb moderat und enttäuschte letztlich, weil sie mit der Entwicklung in den vergleichbaren Industrieländern nicht Schritt hielt und die Situation auf dem Arbeitsmarkt nicht entschärfte. Denn die Arbeitslosigkeit blieb unverändert hoch (2003 und 2004: 10,5 Prozent; 2005: über 11 Prozent), die Staatsverschuldung stieg weiter an (2003 und 2004: 3,9 Prozent), und die Schieflage der Sozialversicherungssysteme nahm zu. Im Bemühen, die Voraussetzungen für eine wirtschaftliche Gesundung nachhaltig zu verbessern, legte Bundeskanzler Schröder im März 2003 ein umfangreiches innenpolitisches Reformprogramm vor (Agenda 2010), bedurfte zu dessen (teilweiser) Durchsetzung jedoch weitgehend der Kooperation mit der Opposition. Eine kurzfristige Besserung der wirtschaftlichen Lage und der Situation auf dem Arbeitmarkt war von diesen Maßnahmen nicht zu erwarten. Sie trugen jedoch zu einer nachhaltigen Verschlechterung des sozialen Klimas bei, weil die Reformen mit dem teilweise massiven Abbau sozialer Leistungen und Rechte verbunden waren. Die Bürger quittierten diese Politik mit negativen Voten bei Landtagswahlen und in Umfragen. Außenpolitisch war die Bundesregierung durch den Irak-Konflikt erstmals in eine klare und aktive Oppositionsrolle zu den Vereinigten Staaten geraten, aus der sie nachhaltig erst nach der Wiederwahl des amerikanischen Präsidenten im November 2004 herausfand. Die durch die Irak-Kontroverse aufgebrochene Kluft hatte sich zuvor schon im Zuge der Einigung über die Europäische Verfassung überbrücken lassen. 7.10.3 Politische Führung Unsicherheiten in der Regierungsarbeit und Konflikte innerhalb der SPD führten zu mehreren Umbildungen der Regierung. Die einschneidendsten Ereignisse in dieser Hinsicht waren der frühe und spektakuläre Rücktritt des Finanzministers Oskar Lafontaine (SPD) am 11. März 1999 aus Protest gegen die Amtsführung des Bundeskanzlers und SPD-Vorsitzenden Gerhard Schröder (Nachfolger: Hans Eichel), die Rücktritte der für Gesundheit und Landwirtschaft zuständigen Minister Andrea Fischer (Bündnis 90/Die Grünen) und Karl-Heinz Funke (SPD) im Gefolge der BSE-Krise im Januar 2001 (Nachfolgerinnen: Ulla Schmidt von der SPD und Renate Künast von Bündnis 90/Die Grünen) sowie die Entlassung von Verteidigungsminister Rudolf Scharping (SPD) nach mehreren Affären im Juli 2002 unmittelbar vor der Bundestagswahl (Nachfolger: Peter Struck). Das nach der Bundestagswahl 2002 neu gebildete Kabinett der rotgrünen Koalition umfasste 14 Ressorts. Bündnis 90/Die Grünen behielten ihre drei Ministerien sowie den Posten des Vizekanzlers für Außenminister Joschka Fischer. Wichtigste Neuerung war die Schaffung eines ,,Superministeriums" für Wirtschaft und Arbeit unter der Führung des bisherigen nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Wolfgang Clement (SPD). Bei den meisten Landtagswahlen seit 1999 erlitt die SPD Niederlagen, zum Teil erdrutschartige. In vier Bundesländern kam es daher schon in der ersten rotgrünen Legislaturperiode zum Machtwechsel zugunsten der CDU; dagegen verlor die CDU in zwei Bundesländern ihre Regierungsbeteiligung als Juniorpartner in großen Koalitionen mit der SPD an die PDS. Auch aus den Wahlen zum Europäischen Parlament am 13. Juni 1999 gingen die Unionsparteien als klare Sieger hervor. Ab 2002 verfügten die unionsgeführten Bundesländer im Bundesrat mit 35 der 69 Stimmen über eine eigene Mehrheit. Seitdem war die rotgrüne Koalitionsregierung bei den im Bundesrat zustimmungspflichtigen Gesetzesvorhaben - sie machten etwa 60 Prozent aller Bundesgesetze aus - auf die Kooperation mit mindestens einem CDU-regierten Bundesland angewiesen. Der schlechte Start der Bundesregierung nach der Bundestagswahl 2002 führte zu weiteren dramatischen Niederlagen der SPD bei Landtagswahlen; die Mehrheitsverhältnisse im Bundesrat veränderten sich weiter zugunsten der unionsgeführten Opposition, die zustimmungspflichtigen Gesetzen nun ihren Stempel aufdrücken konnte. Die CDU als größte Oppositionspartei konnte vom Unmut der Wähler jedoch nur begrenzt profitieren, wurde sie doch mitverantwortlich gemacht für den Sozialabbau und war zudem verstrickt in innere Querelen um eigene Reformkonzepte sowie in Führungsrivalitäten. Eine sinkende Wahlbeteiligung und der Überraschungserfolg der NPD in Sachsen, wo sie mit der SPD fast gleichzog (9,2 Prozent), signalisierten nach Einschätzung von Politikwissenschaftlern einen zunehmenden Vertrauensverlust vieler Bürger in die Kompetenz der etablierten politischen Kräfte, die Zukunftsprobleme des Landes zu lösen. Dank ihrer deutlichen Mehrheit im Bundesrat und damit auch in der Bundesversammlung konnten die bürgerlichen Oppositionsparteien bei der Bundespräsidentenwahl am 23. Mai 2004 ihren Kandidaten, den ehemaligen IWF-Direktor Horst Köhler, durchsetzen; seine von der Regierungskoalition aufgestellte Gegenkandidatin, die Präsidentin der Europa-Universität Viadrina, Gesine Schwan, hatte aufgrund der Mehrheitsverhältnisse von vornherein kaum eine Chance. Am 1. Juli 2004 wurde Köhler als Nachfolger von Johannes Rau im Amt des Bundespräsidenten vereidigt. Aus dessen Schatten löste sich der neue Präsident schnell, indem er die Regierungskoalition durch für sein Amt bisher ungewöhnlich konkrete Stellungnahmen mehrmals aufforderte, die eingeleiteten Reformen von Staat und Wirtschaft weiterzuführen. Infolge der zahlreichen Wahlniederlagen sah Bundeskanzler Schröder die politische Grundlage für die Fortsetzung seiner Arbeit in Frage gestellt und wirkte auf eine Auflösung des Bundestages mittels Vertrauensfrage und auf vorgezogene Neuwahlen im Herbst 2005 hin. Am 21. Juli 2005 löste Bundespräsident Köhler auf Antrag Schröders den Bundestag auf, nachdem Schröder am 1. Juli 2005 die Vertrauensabstimmung wunschgemäß, aber auf verfassungsrechtlich umstrittene Art verloren hatte. Die Neuwahl des Bundestages wurde auf den 18. September 2005 festgesetzt. 7.10.4 Reformpolitik Schwerpunkte zur Auflösung des unter der Regierung Kohl aufgelaufenen ,,Reformstaus" waren in der ersten Legislaturperiode der rotgrünen Koalition die Bereiche Beschäftigungs- und Sozialpolitik, Steuer- und Finanzpolitik sowie Umwelt-, Verbraucher- und Ausländerpolitik. In der zweiten Legislaturperiode wurde 2003 das Reformprogramm als ,,Agenda 2010" zusammengefasst und zugleich erheblich erweitert. 7.10.4.1 Arbeits- und Sozialpolitik Zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit initiierte Bundeskanzler Schröder ein neues ,,Bündnis für Arbeit, Ausbildung und Wettbewerbsfähigkeit". Aufgrund der gegensätzlichen Interessenlage in der Tarifpolitik führte das ,,Bündnis" jedoch nicht zu dem Ziel, Arbeitgeber und Gewerkschaften für eine tragfähige und wirkungsvolle beschäftigungspolitische Zusammenarbeit auf überregionaler Ebene zu gewinnen. Im Herbst 2001 galt das ,,Bündnis für Arbeit" als weitgehend gescheitert. Zur besseren Absicherung geringfügig Beschäftigter und arbeitnehmerähnlicher Selbständiger sowie gleichzeitiger Ausweitung der Beitragspflicht für die Sozialversicherungen kamen im Frühjahr 1999 das Gesetz zur Scheinselbständigkeit und das so genannte 630-DM-Gesetz zur Geltung. Der Eröffnung eines zweiten Arbeitsmarktes auf dem Niedriglohnsektor durch die Förderung von so genannten Mini-Jobs galt auch die Einführung von Kombilohn-Modellen, bei denen Geringverdienern ein Zuschuss zur Sozialversicherung und mehr Kindergeld gewährt wird. Beide Gesetze waren stark umstritten und wurden später revidiert. Zahlreiche neue Möglichkeiten zur effizienteren Vermittlung von Arbeitskräften ermöglichte das ,,Job-AQTIV-Gesetz", u. a. erweiterte es Spielräume zur befristeten Einstellung von Arbeitnehmern (2002). In der Rentenpolitik machte die rotgrüne Koalition die von der Regierung Kohl für 1999 vorbereitete schrittweise Absenkung des Rentenniveaus von 70 auf 64 Prozent rückgängig und senkte - im Gegenzug zur Einführung der ,,Ökosteuer" (siehe unten: Umwelt- und Verbraucherpolitik) - den Beitragssatz zur Rentenversicherung um 1 Prozentpunkt auf 19,3 Prozent, um die konjunkturschädlichen Lohnnebenkosten zu dämpfen. Am 1. Januar 2002 trat eine Rentenreform in Kraft, die das Ziel hatte, den Beitragssatz auf Dauer weitgehend stabil zu halten. Durch die Reform wurde die Ergänzung der gesetzlichen Rente durch eine freiwillige private, kapitalgedeckte Eigenvorsorge staatlich gefördert (,,Riester-Rente"). Die Fehlbeträge in den Rentenkassen stiegen jedoch weiter an. In der Reform des Gesundheitswesens gelang der rotgrünen Koalition nicht der entscheidende Durchbruch. Mit dem Gesundheitsreformgesetz (2000) konnten nur diejenigen der Maßnahmen zur Eindämmung der Ausgabensteigerungen durchgesetzt werden, die nicht der Zustimmung des von der Opposition dominierten Bundesrats bedurften. 2002 wurde die Budgetierung der ärztlich veranlassten Arzneimittelausgaben wieder aufgehoben; zugleich wurde das Krankenkassensystem im Hinblick auf den so genannten Risikokostenstrukturausgleich reformiert. Mit dem Ziel, Deutschland bis 2010 in Wirtschaft, Wissenschaft und Bildung wieder an die Weltspitze zu bringen, stellte Bundeskanzler Schröder nach seiner Wiederwahl in der ,,Agenda 2010" seine Pläne für den Umbau der Sozialsysteme, der Arbeitsmarktregularien und des Steuer- und Finanzsystems vor. Bis Ende 2003 wurden nach Kompromissen mit der Opposition mehrere Gesetzespakete beschlossen, die 2004 in Kraft traten. Im Kern ging es bei den angezielten Strukturreformen, die von Expertengremien (,,Hartz-Kommission", ,,Rürup-Kommission") entworfen worden waren, darum, die Wirtschaft von Steuern und Lohnnebenkosten für die Sozialsysteme zu entlasten, diese damit selbst auf die veränderten wirtschaftlichen, sozialen und demographischen Bedingungen einzustellen, den Arbeitsmarkt flexibler zu gestalten und bürokratische Hemmnisse für die wirtschaftliche Entfaltung zu beseitigen. Die konkreten Maßnahmen sollten die Abschaffung von Subventionen und Steuervorteilen einschließen und dem Bürger mehr Eigeninitiative und Eigenleistung bei der Existenzsicherung abverlangen. Die Gewerkschaften und der linke Flügel der SPD sperrten sich vergeblich gegen den teilweise massiven Abbau von sozialen Leistungen. Als erstes Vorhaben wurde unter Mitwirkung der Opposition eine Gesundheitsreform auf den Weg gebracht, durch die die Kassen der gesetzlichen Krankenversicherung bis 2007 um bis zu 23 Milliarden Euro entlastet werden sollten, um den Beitragssatz stufenweise senken zu können. Die Einsparungen sollten u. a. durch die Erhebung einer Praxisgebühr, Streichung oder Einschränkung der Kostenübernahme ärztlicher Leistungen und Zuzahlungen bei Sachleistungen und Medikamenten erzielt werden. Die schon zuvor eingeleiteten arbeitsmarktbezogenen Reformen wurden in vier Blöcken (,,Hartz I" bis ,,Hartz IV", siehe Hartz-Reformen) umgesetzt. Sie führten zu einer Neuorganisation der Arbeitsvermittlung nach Grundsätzen eines modernen öffentlichen, teils privatisierten Dienstleistungsmanagements (Hartz I und Hartz II). Die Bundesanstalt für Arbeit wurde neu strukturiert, in Bundesagentur für Arbeit (BA) umbenannt (Hartz III), ihre Vermittlungsarbeit erfolgt in neu geschaffenen ,,Job-Centern" und wird durch privatwirtschaftlich organisierte ,,Personal-Service-Agenturen" ergänzt. Die Voraussetzungen für den - zeitlich verkürzten - Anspruch auf reguläres Arbeitslosengeld aus der beitragsfinanzierten Arbeitslosenversicherung (,,Arbeitslosengeld I") wurden verschärft. Zugleich wurde der Anreiz geschaffen, sich als Kleinstunternehmer selbständig zu machen (,,Ich-AG"). Als weiteres Kernstück der Reformen erfolgte unter dem Motto ,,Fördern und Fordern" zum 1. Januar 2005 die Zusammenlegung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe nach dem als ,,Hartz IV" bezeichneten Reformmodul. Die Arbeitslosenhilfe für Langzeitarbeitslose wurde in ein ,,Arbeitslosengeld II" umgewandelt, das nach einer Übergangszeit das Niveau der Sozialhilfe erreicht und von der Bundesanstalt für Arbeit ausgezahlt wird. Wenn eine Beschäftigung für den Arbeitslosen im so genannten ersten Arbeitsmarkt nicht zu finden ist, muss er gemeinnützige Arbeitsgelegenheiten mit geringer Aufwandsentschädigung annehmen, (so genannte Ein-Euro-Jobs), die nicht auf das Arbeitslosengeld II angerechnet wird. Zur kurzfristigen Stabilisierung des Beitragssatzes in der Rentenversicherung trat 2004 ein ,,Notpaket" von Sofortmaßnahmen in Kraft. So gab es 2004 erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik keine Rentenerhöhung. Zum 1. Januar 2005 trat eine lange umstrittene Rentenreform in Kraft, die durch Aufnahme eines so genannten Nachhaltigkeitsfaktors das System der Rentenversicherung auf eine solide Finanzierungsbasis stellen und damit auch den Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt sowie der steigenden Lebenserwartung Rechnung tragen sollte. Unter dem Eindruck der katastrophal schlechten Wahlergebnisse für die SPD, mit denen die Wähler die als Sozialabbau wahrgenommene Arbeitsmarktreform abstraften, begann die rotgrüne Regierungskoalition schon bald nach In-Kraft-Treten von Hartz IV mit der Korrektur einiger Vorschriften und ließ mit Blick auf die nächste Bundestagswahl erkennen, dass ihr Eifer zu sozial schmerzhaften Reformen erschöpft sei. 7.10.4.2 Steuer- und Finanzpolitik Bundesfinanzminister Hans Eichel versuchte, durch einen harten Sparkurs das Haushaltsdefizit zu begrenzen. Im Mai und Juli 2000 brachte er gegen den Widerstand der Opposition die bis dahin weitreichendste Steuerreform in der Geschichte der Bundesrepublik durch das Parlament. Unter anderem wurde bis 2005 der Eingangssteuersatz in drei Stufen von 22,9 auf 15 Prozent und der Spitzensteuersatz von 51 auf 42 Prozent gesenkt, die Körperschaftssteuer wurde auf einheitlich 25 Prozent reduziert. Zur Gegenfinanzierung der Steuerentlastungen, bis 2005 auf rund 31 Milliarden Euro berechnet, wurden zahlreiche Vergünstigungen und Subventionen abgebaut. Über eine umfassende Strukturreform des Steuersystems konnten sich Regierungskoalition und Opposition nicht verständigen, obwohl sie in der Zielsetzung - Transparenz und Vereinfachung der Steuervorschriften und starke Steuerentlastung für möglichst viele Bürger - nahe beieinanderlagen. Angesichts der Schwierigkeit, die Steuerentlastung bei leeren öffentlichen Kassen gegenzufinanzieren, war vor allem das Ausmaß der Erleichterungen umstritten. Seit 2002 hatte die Regierung in ihrer Haushaltspolitik immer wieder die selbst gesetzten Ziele und die vom Eurostabilitätspakt vorgegebene Marke (jährliche Neuverschuldung höchstens 3 Prozent des Bruttoinlandsprodukts) verfehlt. Die Defizitquote lag 2001 bei 2,6 Prozent, 2002 bei 3,8 Prozent und überschritt auch 2003 und 2004 mit 3,9 Prozent des Bruttoinlandsprodukts sowie 2005 mit 3,3 Prozent die Stabilitätsmarke erheblich. 7.10.4.3 Umwelt- und Verbraucherpolitik Durch die erstmalige Beteiligung der Umweltpartei Bündnis 90/Die Grünen an einer Bundesregierung gewannen der Umwelt- und der Verbraucherschutz einen besonderen Stellenwert. Als eines der wichtigsten ökologie- und zugleich steuerpolitischen Vorhaben brachte die rotgrüne Koalition 1999 gegen den heftigen Widerstand der Opposition die so genannte ökologische Steuerreform auf den Weg. Durch eine verstärkte steuerliche Belastung des Verbrauchs nicht erneuerbarer Energieträger (Benzin, Mineralöl, Erdgas) sollten Anreize zum Energiesparen und umweltfreundlicheren Energieverbrauch gegeben werden. Die Ökosteuer wurde in fünf Stufen bis 2004 umgesetzt. Von vornherein zweckbestimmt, dienten die Einnahmen zum Ausgleich der Mindereinnahmen infolge der Absenkung des Beitragssatzes zur Rentenversicherung ( siehe oben: Sozialpolitik). Im Konflikt über die Zukunft der Kernenergie wurde 2000 mit den Energieversorgungsunternehmen ein Kompromiss erzielt, der in der Atomrechtsnovelle von 2002 Gesetzeskraft erlangte. Da die Regellaufzeit der 19 noch am Netz befindlichen Atomkraftwerke auf 32 Jahre pro Reaktor begrenzt wurde, soll sich der allmähliche Ausstieg aus der Produktion von Atomenergie im Zeitraum von 20 Jahren vollziehen. 2002 trat ein neues Bundesnaturschutzgesetz in Kraft, das in Fragen des Naturschutzes erstmals die Vereinsklage in das Bundesrecht einführte und jedes Bundesland verpflichtete, mindestens 10 Prozent seiner Fläche für die Entwicklung eines großflächigen Biotopverbundes bereitzustellen. In Reaktion auf die im November 2000 auch in Deutschland akut gewordene BSE-Krise versuchte Bundeskanzler Schröder dem Vertrauensverlust der Bevölkerung entgegenzuwirken, indem er die Kompetenzen neu ordnete. Nach dem Rücktritt von Landwirtschaftsminister Funke erhielt Renate Künast im Januar 2001 die Leitung des Ministeriums, in dessen Bezeichnung ,,für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft" erstmals der Verbraucherschutz als vorrangiges Politikfeld erschien. Sie leitete eine Neuorientierung der Agrarpolitik ein, indem sie - teils gegen den heftigen Widerstand der lobbystarken Bauernschaft - eine für den Konsumenten transparente Agrarproduktion, artgerechte Tierhaltung und die Stärkung regionaler Strukturen förderte. 7.10.4.4 Ausländerpolitik 2000 trat eine Reform des Staatsbürgerschaftsrechts in Kraft. In Deutschland geborene Kinder ausländischer Eltern erhalten neben der elterlichen auch die deutsche Staatsbürgerschaft; sie besitzen also eine doppelte Staatsbürgerschaft. Der ,,Doppelpass" gilt bis zu ihrem 23. Lebensjahr, bis zu dem sie sich für eine der beiden Staatsbürgerschaften entschieden haben müssen. Ausländer, die mindestens acht Jahre (bisher 15 Jahre) in Deutschland leben, haben unter bestimmten Voraussetzungen Anspruch auf Einbürgerung. Unter dem Eindruck anwachsender Asylbewerberzahlen und zunehmender Fremdenfeindlichkeit, die mit der wachsenden Arbeitslosigkeit einherging, versuchte die Koalition eine Wende in der Zuwanderungspolitik herbeizuführen. Einerseits sollte die Aufnahme von Ausländern strikt begrenzt und von den Erfordernissen des Arbeitsmarktes abhängig gemacht werden, zugleich aber an die humanitären Verpflichtungen anerkannten Asylbewerbern gegenüber gebunden bleiben und die Integration der in Deutschland verbleibenden Ausländer fördern. Der jahrelange Streit über das von der Bundesregierung vorgelegte Zuwanderungsgesetz mündete im März 2002 in einen Eklat. Erst Mitte 2004 verständigten sich Regierung und Opposition auf einen Kompromiss, der insgesamt eine erhebliche Verschärfung des Ausländerrechts brachte. Besondere Beachtung fanden Sicherheitsaspekte. So können Ausländer schon mit dem begründeten Verdacht auf Terrorismusbezug sowie ,,geistige Brandstifter" und ,,Hassprediger" abgeschoben werden. Wenn dies nicht möglich ist, weil den Betroffenen in ihrem Heimatland Tod oder Folter drohen, können sie dauerhaft unter strikte Überwachung gestellt werden. Die Zuwanderung hoch qualifizierter Arbeitskräfte dagegen wurde erleichtert. Das humanitäre Recht wurde insofern verbessert, als nun auch Opfer nichtstaatlicher und geschlechtsspezifischer Verfolgung im Sinne der Genfer Konvention als Flüchtlinge anerkannt werden können. Des Weiteren sah das Gesetz vor, die Integration von Ausländern durch Sprach- und Integrationskurse zu fördern. 7.10.5 Deutsche Einheit und Aufarbeitung der Vergangenheit In die erste Regierungszeit der rotgrünen Koalition fielen mehrere wichtige Daten und Entscheidungen von Bedeutung für das nationale Selbstverständnis. So wurde das 50jährige Bestehen der Bundesrepublik Deutschland am 23. Mai 1999 mit der Einsetzung Berlins als neuem Regierungssitz gekoppelt sowie mit der Entscheidung, ein nationales Holocaust-Mahnmal in der Hauptstadt zu errichten, das zwei Tage nach dem 60. Jahrestag des Kriegsendes, am 10. Mai 2005, eröffnet wurde. Der zehnte Jahrestag der wiedergewonnenen Deutschen Einheit am 3. Oktober 2000 gab Anlass zu einer selbstkritischen Bilanz. Bundestagspräsident Wolfgang Thierse stellte fest, die wirtschaftliche und soziale Lage in Ostdeutschland stehe ,,auf der Kippe" und enttäuschte Hoffnungen auf einen schnellen Aufholprozess verbänden sich bei vielen früheren DDR-Bürgern mit einem wachsenden Vertrauensverlust. Im September 1999 wurde die für die Aufarbeitung des DDR-Unrechts zuständige Staatsanwaltschaft des Berliner Landgerichts aufgelöst. Bis dahin waren fast alle der 22 854 Ermittlungsverfahren abgeschlossen und von 1 065 angeklagten Personen 335 rechtskräftig verurteilt worden. Um einen weiteren Teil des Erbes des nationalsozialistischen Regimes aufzuarbeiten, kam es nach mehrjährigen Verhandlungen im Jahr 2000 zur Einrichtung eines Entschädigungsfonds für Zwangsarbeiter im 2. Weltkrieg. Von der deutschen Wirtschaft und dem Staat getragen und mit rund fünf Milliarden Euro ausgestattet, gewährte die zu diesem Zweck gegründete Stiftung ,,Erinnerung, Verantwortung und Zukunft" noch lebenden ehemaligen Zwangsarbeitern eine eher symbolische Entschädigung für die damalige Ausbeutung durch die NS-Diktatur. 2005 waren die Zahlungen an Opfergruppen und rund 1,8 Millionen ehemalige Zwangsarbeiter weitgehend abgeschlossen. 7.10.6 Innere Sicherheit - ,,Antiterrorkampf" Die Terroranschläge in den USA am 11. September 2001 hatten auch tief greifende Auswirkungen auf das politische Klima in Deutschland und die Einschätzung der eigenen Bedrohungslage. Dies umso mehr, als sich bald erwies, dass drei der 19 Flugzeugentführer einer Al-Qaida-Zelle in Hamburg angehörten, die Verbindungen zu militanten Islamisten in Deutschland und im Ausland hatte. Im Eilverfahren wurde eine umfangreiche Antiterrorgesetzgebung zur Verabschiedung gebracht, die in zwei ,,Paketen" im Dezember 2001 und im Januar 2002 in Kraft trat. Zur Finanzierung der mit ihrer Umsetzung verbundenen Kosten wurden die Tabak- und die Versicherungssteuer angehoben. Die wichtigsten Regelungen betrafen die Verbesserung der Reaktionsfähigkeit der Bundeswehr, der Ermittlungsmöglichkeiten der Sicherheitsdienste und Strafverfolgungsbehörden, der Sicherheit im Luftverkehr, der Personenidentifizierung und -kontrolle sowie der Kontrolle und des Verbots extremistischer Ausländervereine in Deutschland. Darüber hinaus wurde 2004 die Abteilung ,,Gruppe Internationaler Terrorismus" des Bundeskriminalamts errichtet und der Aufbau einer zentralen Datenbank zur Überwachung des islamistischen Extremismus (,,Islamistendatei") in Angriff genommen. Nach einer großen Anzahl Razzien und dem Verbot von extremistischen islamistischen Organisationen wurden in Deutschland zahlreiche Ermittlungsverfahren mit islamistisch-terroristischem Hintergrund eingeleitet. Ende 2004 gab es etwa 160 laufende Verfahren, von denen 107 von der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe wegen Bildung einer terroristischen Vereinigung (48) oder gegen mutmaßliche ausländische Terroristen (59) betrieben wurden. Im weltweit ersten Prozess gegen einen mutmaßlichen Helfer der Attentäter vom 11. September 2001 wurde der Marokkaner Mounir el Motassadeq im Februar 2003 in Hamburg wegen Beihilfe zum Mord in 3 066 Fällen zur Höchststrafe von 15 Jahren Haft verurteilt. Der Bundesgerichtshof hob das Urteil im März 2004 wegen unklarer Beweislage jedoch auf; das Verfahren musste neu aufgerollt werden. Schließlich wurde nach einem Zug durch die Instanzen Anfang 2007 das ursprüngliche Urteil bestätigt. 7.10.7 Außen- und Sicherheitspolitik In der Außen-, Sicherheits- und Europapolitik folgte die rotgrüne Koalition in ihrer ersten Legislaturperiode im Wesentlichen dem von der konservativ-liberalen Regierung Kohl vorgezeichneten Kurs. Die Kontroverse mit den USA und einem Teil der europäischen Partner in der Frage des Irak-Krieges brach mit dieser Kontinuität und führte auch auf außenpolitischem Gebiet zu einer zeitweise scharfen Konfrontation zwischen Regierung und Opposition. Schon bald nach ihrem Amtsantritt sah sich die neue Bundesregierung mit dem Kosovo-Konflikt konfrontiert. Noch der alte Bundestag billigte im Oktober 1998 grundsätzlich eine deutsche Beteiligung an einem möglichen NATO-Militäreinsatz gegen die Bundesrepublik Jugoslawien und die Bereitstellung von Kampfflugzeugen mit Personal. Am 25. Februar 1999 wurde die Entsendung eines unter NATO-Kommando stehenden Bundeswehrkontingents beschlossen. Die Luftangriffe, die am 24. März 1999 begannen und zehn Wochen dauerten, wurden mit der Notwendigkeit einer humanitären Intervention zur Verhinderung von Völkermord, Vertreibung und ,,ethnischer Säuberung" begründet, waren aber völkerrechtlich umstritten, da kein Mandat der Vereinten Nationen vorlag. Das deutsche Engagement führte daher zu einer Zerreißprobe in Bündnis 90/Die Grünen, in der sich Außenminister Joschka Fischer mit seinem den NATO-Einsatz befürwortenden Kurs durchsetzte. Nach dem Kosovo-Krieg stellte die Bundeswehr zunächst rund 8 500 Soldaten für die mit UN-Mandat versehene Friedenstruppe Kosovo Force (KFOR) ab; in der Folgezeit wurde die Truppenstärke sukzessive reduziert. Auch bei der Befriedung der anderen Konflikte auf dem Balkan spielte Deutschland eine wesentliche Rolle. Schon seit 1996 war die Bundeswehr in Bosnien und Herzegowina engagiert, zunächst im Rahmen der SFOR, ab Dezember 2004 als Teil der EU-geführten Operation ,,Althea". Nach dem Friedensabkommen von Ohrid in Makedonien nahm die Bundeswehr im Herbst 2001 an der von der makedonischen Regierung erbetenen NATO-Mission teil. Maßgeblich auf deutsche Initiative hin wurde im Juni 1999 in Köln der Balkan-Stabilitätspakt ins Leben gerufen. Nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 in den USA versicherte Bundeskanzler Schröder die USA der ,,uneingeschränkten Solidarität" der Bundesrepublik im Kampf gegen den Terrorismus, gab nebenher aber auch zu verstehen, dass dies eine Beteiligung an ,,Abenteuern" nicht einschließe. Auf ein entsprechendes Ersuchen der USA hin entsandte die Bundesregierung im Januar 2002 bis zu 3 900 deutsche Soldaten zur Unterstützung des Krieges der USA gegen das Taliban-Regime in Afghanistan in der Operation Enduring Freedom. Die Bundeswehr stellte hauptsächlich Überwachungs- und Abwehrkräfte sowie logistische Verbände zur Verfügung, aber auch Elitesoldaten des Kommandos Spezialkräfte (KSK), und sie operierte nur außerhalb des eigentlichen Kampfgebietes. Nach der Bildung einer provisorischen Regierung in Afghanistan beteiligte sich Deutschland ab Anfang 2002 mit zunächst bis zu 1 200 Soldaten an der Sicherheitsunterstützungstruppe der Vereinten Nationen für Afghanistan (International Security Assistance Force, ISAF). In der Folgezeit wurde die deutsche Präsenz in Afghanistan - regelmäßig vom Bundestag bestätigt - personell und räumlich ausgeweitet; zugleich wurde das militärische Engagement im Rahmen von Enduring Freedom schrittweise verringert. Als sich im Sommer 2002 die Absicht der USA abzeichnete, einen so genannten Präventivkrieg gegen den Irak zu führen, um dort einen Regimewechsel zu erzwingen, erklärte Bundeskanzler Schröder am 27. August, Deutschland werde sich an einer militärischen Aktion nicht beteiligen. Damit leitete er eine drastische Verschlechterung des Verhältnisses zu den USA ein, entsprach jedoch der Mehrheitsmeinung in der Bevölkerung und konnte im Wahlkampf punkten. Die Irak-Krise war 2003 beherrschendes Thema in Deutschland und strahlte auch auf andere Gebiete der Außenpolitik aus. Auf den Gang der Ereignisse hatte die deutsche Diplomatie insofern einen wichtigen Einfluss, als Deutschland seit Januar 2003 für zwei Jahre nichtständiges Mitglied im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen war und im Februar 2003 die Präsidentschaft innehatte. In enger Zusammenarbeit mit anderen Staaten, vor allem Frankreich und Russland, wirkte die deutsche Regierung erfolgreich darauf hin, einen Beschluss des Sicherheitsrats zu verhindern, der die USA und Großbritannien kurzfristig zum Angriff auf den Irak legitimiert hätte. Den Beginn des Irak-Krieges am 20. März 2003 kritisierte Bundeskanzler Schröder scharf. In diesem Punkt wusste er sich einig mit einer großen Mehrheit der Bevölkerung. Meinungsumfragen zufolge lehnten etwa 85 Prozent der Deutschen einen Militärschlag gegen den Irak ab. Nach Ende der Kriegshandlungen erklärte sich die Bundesregierung zu einem finanziellen Engagement im Irak nur unter der Voraussetzung bereit, dass der Wiederaufbauprozess unter Verantwortung einer UN-Verwaltung erfolge. Ein militärischer Beitrag zur Friedenssicherung im Irak komme nur in Frage, wenn ein UN-Mandat vorliege und wenn eine legitimierte irakische Regierung die Hilfe anfordere. Das deutsche Verhalten in der Irak-Krise trübte das Verhältnis zu den USA schwer. Erst der Besuch von Bundeskanzler Schröder bei Präsident George W. Bush im Februar 2004 dokumentierte wieder einen freundlich-geschäftsmäßigen Umgang. Die Qualität der früheren vertrauensvollen und engen Zusammenarbeit der Bündnispartner war damit aber noch nicht erreicht. In der Europapolitik pflegte die rotgrüne Regierung Kontinuität. Gemeinsam mit Frankreich förderte Deutschland die Intensivierung wie auch die Erweiterung der Union. Im November 2001 ergriff Bundeskanzler Schröder zusammen mit dem französischen Staatspräsidenten Jacques Chirac die Initiative für die Ausarbeitung des Entwurfs einer Europäischen Verfassung durch einen Europäischen Konvent, der im Februar 2002 seine Arbeit aufnahm. Die Irak-Krise führte in der EU zu einer tiefen Kluft zwischen Befürwortern und Gegnern des amerikanisch-britischen Vorgehens. Die Solidarität, die im Vorfeld des IrakKrieges insgesamt 18 europäische Regierungen gegenüber den USA erklärten - in der Regel allerdings offenbar gegen die Mehrheitsmeinung ihrer Bevölkerung -, enthielt indirekt auch eine Stoßrichtung gegen den faktischen deutsch-französischen Führungsanspruch in Europa. Ein Krisengipfel des Europäischen Rats am 17. Februar 2003, auf dem Bundeskanzler Schröder die Kompromissformulierung ,,Gewalt sollte nur als letztes Mittel eingesetzt werden" akzeptierte, überbrückte die Differenzen nur scheinbar. Die enge Zusammenarbeit mit Frankreich zeigte sich auch bei den Beratungen des Europäischen Konvents über den Entwurf einer EU-Verfassung, in denen sich die beiden größten EU-Staaten in wichtigen Punkten durchsetzten. Nach der Unterzeichnung des Verfassungsvertrags durch die Staats- und Regierungschefs der EU am 20. Oktober 2004 brachte die Bundesregierung im Februar 2005 den Gesetzentwurf zur Ratifizierung des EU-Verfassungsvertrags in die parlamentarischen Gremien ein; am 12. und am 27. Mai 2005 nahmen Bundestag und Bundesrat jeweils mit großer Mehrheit den Verfassungsvertrag an. 7.11 Bundeskanzlerin Merkel und die zweite große Koalition Im Vorfeld der vorgezogenen Bundestagswahl am 18. September 2005, die Bundeskanzler Schröder durch seine ,,unechte" Vertrauensfrage herbeigeführt hatte, wiesen alle Umfragen auf einen klaren Sieg einer christlich-liberalen Koalition unter der Führung der CDU-Kanzlerkandidatin Angela Merkel hin. Für die regierende SPD wurden große Verluste prognostiziert, die vor allem aus der Abwanderung vieler mit dem Sozialabbau der rotgrünen Regierung Unzufriedener zur Linkspartei resultieren würden. Als ,,Die Linkspartei" oder ,,Die Linke" firmierte seit Juli 2005 die PDS, seit sich die nahezu ausschließlich in den neuen Bundesländern starke Partei mit der erst im Januar 2005 gegründeten, ebenfalls linken und vor allem in den alten Bundesländern verankerten Partei Arbeit & soziale Gerechtigkeit - Die Wahlalternative (WASG) auf eine Zusammenarbeit geeinigt hatte. Diese Zusammenarbeit, die mittelfristig zu einer Fusion der beiden Parteien führen sollte, konkretisierte sich zunächst in einer Öffnung der Wahllisten der PDS für Kandidaten der WASG. Die Verluste der SPD fielen weniger drastisch aus als prognostiziert: Sie kam auf 34,2 Prozent der Stimmen und 222 Mandate (4,4 Prozentpunkte weniger als 2002). Nur 1 Prozentpunkt und vier Sitze mehr gewannen - allen Prognosen zum Trotz - CDU/CSU (35,2 Prozent und 226 Mandate; gegenüber 2002 ein Verlust von 3,3 Prozentpunkten). Drittstärkste Partei wurde die FDP mit 9,8 Prozent und 61 Mandaten, gefolgt von der Linken mit 8,7 Prozent und 54 Mandaten und Bündnis 90/Die Grünen als schwächster Fraktion mit 8,1 Prozent und 51 Mandaten. CDU/CSU und FDP verfehlten also klar die für die Bildung einer stabilen Regierung notwendige Mehrheit von mindestens 308 Sitzen, deutlicher noch SPD und Bündnis 90/Die Grünen. Da die SPD schon im Vorfeld der Wahlen eine Zusammenarbeit mit der Linkspartei eindeutig ausgeschlossen hatte, für die Grünen eine Zusammenarbeit mit der FDP - etwa in Form einer Koalition aus CDU/CSU, FDP und Grünen (wegen der Farben Schwarz, Gelb und Grün Jamaika-Koalition genannt) oder SPD, FDP und Grünen - nicht in Frage kam, blieb nur noch die Option einer großen Koalition aus CDU/CSU und SPD. Nachdem sich Union und SPD in der wichtigsten Personalfrage, der Kanzlerfrage, verständigt hatten, und zwar auf Angela Merkel, nahmen beide Seiten formelle Koalitionsverhandlungen auf. In den Koalitionsverhandlungen erzielten Union und SPD in den meisten Punkten Einvernehmen, so etwa bei der Erhöhung der Mehrwertsteuer von 16 auf 19 Prozent (die Union hatte während des Wahlkampfes eine Erhöhung auf 18 Prozent gefordert, was die SPD damals noch als unsozial und als Aufschwungsbremse zurückgewiesen hatte), dem Abbau von Steuervergünstigungen, der Lockerung des Kündigungsschutzes und bei der Förderung der mittelständischen Wirtschaft. Kontroverse Themen wie etwa Gesundheitswesen und Atomenergie wurden aus den Verhandlungen ausgeklammert und auf einen späteren Termin vertagt. Leichte Irritationen ergaben sich während der Verhandlungen durch den unerwarteten Rücktritt Franz Münteferings vom Amt des SPD-Vorsitzenden und den Rückzug des designierten Wirtschafts- und Technologieministers Stoiber. Am 11. November 2005 wurde der Koalitionsvertrag für die zweite große Koalition in der Geschichte der Bundesrepublik unterzeichnet, wenig später billigten ihn die Parteitage von CDU, CSU und SPD. Am 22. November 2005 wählte der Bundestag mit 397 Ja-Stimmen (die Koalition verfügt über 448 Stimmen) bei 202 Gegenstimmen Angela Merkel zur Bundeskanzlerin; am selben Tag wurden Merkel und ihre Regierung vereidigt. Der Regierung gehören außer der Bundeskanzlerin 14 Ministerinnen und Minister an sowie der Chef des Bundeskanzleramtes. Acht Ministerinnen und Minister stellt die SPD, darunter den Minister für Arbeit und Soziales (zunächst Franz Müntefering, ab November 2007 Olaf Scholz) sowie drei aus der Vorgängerregierung übernommene Ressortchefs (Frank-Walter Steinmeier als Außenminister sowie Ulla Schmidt und Brigitte Zypries in ihren alten Ressorts), die CDU stellt fünf Kabinettsmitglieder (darunter Wolfgang Schäuble als Innenminister), und die CSU ist mit zwei Ministern in der Regierung vertreten (Horst Seehofer und Michael Glos). Vizekanzler war bis zu seinem Ausscheiden aus dem Kabinett Müntefering, anschleißend übernahm Steinmeier den Posten. 7.11.1 Reformen im Inneren Die Regierung der großen Koalition setzte im Wesentlichen und ohne große Akzentverschiebungen die Politik ihrer rotgrünen Vorgängerin fort, denn die großen Herausforderungen, etwa der Kampf gegen eine weiterhin hohe Arbeitslosigkeit, waren dieselben geblieben. Auf dem Arbeitsmarkt zeichnete sich ein Aufschwung ab; so sank die Arbeitslosenquote von mehr als 11 Prozent 2005 auf 10,8 Prozent 2006 und 9 Prozent 2007. Diese positive Entwicklung war teils auf die Arbeitsmarktreformen der Vorgängerregierung zurückzuführen, teils auf einen relativ stabilen konjunkturellen Aufschwung, für den ebenfalls bereits die Regierung Schröder die Grundlagen geschaffen hatte. Allerdings erwiesen sich die Arbeitsmarktreformen (die Hartz-Reformen) bei einer Überprüfung ihrer Wirksamkeit in Teilen als mangelhaft, d. h., sie verfehlten in Teilen ihr Ziel, zum Abbau von Arbeitslosigkeit beizutragen, wie etwa die Personal-Service-Agenturen oder die Ein-Euro-Jobs. Letztere brachten zwar Hunderttausende wieder in Beschäftigung, jedoch nicht in längerfristige, sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse. Da es erheblich mehr Arbeitslosengeld-II-Berechtigte gab als bei dessen Einführung erwartet und sich somit eine gewaltige Finanzierungslücke auftat, wurde 2006 eine ganze Reihe von Leistungen im Rahmen des Arbeitslosengeldes II gekürzt. Wie die Arbeitsmarktpolitik hatte auch die Finanz- und Wirtschaftspolitik positive Zahlen zu vermelden: Das Wirtschaftswachstum betrug 2006 2,7 Prozent; die Einnahmen des Staates übertrafen die Erwartungen bei weitem, so dass sich auch die Defizitquote auf 1,7 Prozent des BIP reduzierte, womit Deutschland zum ersten Mal seit fünf Jahren wieder das Defizitkriterium des Eurostabilitätspaktes erfüllte. Für 2007 wurde sogar mit einer Defizitquote von nur noch 1,2 Prozent des BIP gerechnet, was nicht zuletzt der Erhöhung der Mehrwertsteuer zum 1. Januar 2007 von 16 auf 19 Prozent geschuldet war (der ermäßigte Steuersatz von 7 Prozent blieb bestehen). Das Wirtschaftswachstum betrug 2007 allerdings nur noch 2,4 Prozent. Die Mehreinnahmen aus der Mehrwertsteuererhöhung werden zu zwei Dritteln für die Haushaltssanierung verwendet; das restliche Drittel dient zur Senkung der Lohnnebenkosten und fließt in die Arbeitslosenversicherung, wodurch die Beiträge um 2 Prozentpunkte auf 4,5 Prozent gesenkt werden konnten. Die Mehrwertsteuererhöhung war die größte Steuererhöhung in der Geschichte der Bundesrepublik. Für 2008 wurde eine weitreichende Unternehmenssteuerreform beschlossen, die für Kapitalgesellschaften eine Senkung der Steuerlast von etwa 39 Prozent auf unter 30 Prozent vorsieht. Diese Reform soll verhindern, dass Arbeitsplätze und Investitionen aus Kostengründen ins Ausland abwandern. Um dem demographischen Wandel - dem Älterwerden der Gesellschaft bei gleichzeitigem Geburtenrückgang - gerecht zu werden, leitete die Regierung Merkel Reformen in der Familien- und in der Rentenpolitik ein. In der Rentenpolitik wird u. a. das reguläre Renteneintrittsalter bis 2029 schrittweise auf 67 Jahre angehoben, und zum 1. Januar 2007 wurde der Rentenversicherungsbeitrag auf 19,9 Prozent erhöht; gleichzeitig wurde versichert, dass der Beitragssatz in den folgenden Jahren nicht über 20 Prozent steigen werde. Des Weiteren wurde die staatlich geförderte ,,Riester-Rente" ausgebaut, und schließlich wurden Rentenerhöhungen beschlossen: ab Juli 2007 um 0,54 Prozentpunkte - die erste, allerdings minimale Rentenerhöhung seit drei Jahren - und ab Juli 2008 außerplanmäßig um 1,1 Prozentpunkte. Die Rentenerhöhung von 2008 stieß wegen der zu erwartenden Kosten, die zu Lasten der jungen Generation gingen, die die Kosten zu begleichen hat, auf scharfe Kritik, und sie wurde als Wahlgeschenk an die zunehmende und nicht zu übergehende Zahl der Rentner gewertet. Die Familienpolitik zielte in erster Linie auf die Förderung berufstätiger Eltern ab. So können etwa berufstätige Paare seit 2006 Betreuungskosten bis zu einer Höhe von 4 000 Euro pro Jahr und Kind (bis 14 Jahre) von der Steuer absetzen. Um berufstätigen Paaren überhaupt die Entscheidung für ein Kind zu erleichtern, wurde - nach langen, kontroversen Diskussionen - zum 1. Januar 2007 das Elterngeld eingeführt. Kritisiert wurde an dem Elterngeld, dass es vor allem Wenigverdienende und Arbeitslose schlechter stellt als das bis dahin gezahlte Erziehungsgeld; außerdem wurde bemängelt, dass bei weitem nicht genügend Betreuungsmöglichkeiten für die Kinder zur Verfügung stünden, wenn die betreuenden Elternteile nach Auslaufen des Elterngeldes in die Berufstätigkeit zurückkehren wollten. Um diesem Problem entgegenzuwirken, beschloss die Bundesregierung, bis 2013 die Zahl der Betreuungsplätze für unter Dreijährige von rund 285 000 auf 750 000 aufzustocken. Der notwendige und erwartete Durchbruch in der Gesundheitspolitik gelang wie der Vorgängerregierung auch der Regierung Merkel nicht, u. a. weil die Vorstellungen der Koalitionspartner CDU/CSU und SPD zu weit auseinanderlagen. Erst im Sommer 2006 kam eine Einigung zwischen den Koalitionspartnern über die Eckpunkte einer Gesundheitsreform zustande, und zum 1. April 2007 trat ein erster Teil der Reform in Kraft. Dieses Reformpaket zielte vor allem auf eine Förderung des Wettbewerbs unter den Krankenkassen ab (u. a. durch differenziertere Tarife und Angebote), um deren Leistungen zu verbessern und die Kosten zu senken, und es erweiterte auch das Leistungsspektrum der gesetzlichen Krankenkassen. Dass diese Reform die Finanzierbarkeit des Gesundheitssystems sichert, wird jedoch von vielen Seiten bezweifelt. Umstritten ist auch der so genannte Gesundheitsfonds, der 2009 - deutlich später als ursprünglich geplant - eingeführt werden soll. Der Gesundheitsfonds speist sich aus den Arbeitgeber- und den Arbeitnehmerbeiträgen der gesetzlichen Krankenkassen sowie aus Steuern und leitet diese Mittel dann an die Krankenkassen in Form einer Grundpauschale pro Versicherten weiter; reicht den Kassen dies nicht aus, können sie von ihren Versicherten einen Zusatzbeitrag verlangen. Ein weiteres umfangreiches, bereits mehrere Jahre lang diskutiertes Reformprojekt war die zum 1. September 2006 in Kraft getretene Föderalismusreform; sie war die größte Reform des Grundgesetzes seit seinem In-Kraft-Treten 1949. Durch diesen ersten Teil der Föderalismusreform - ein zweiter zur Neuregelung der Finanzbeziehungen soll folgen - wurden vor allem die Kompetenzen von Bund und Ländern entflochten und zum Teil neu zugeordnet. So wurde u. a., um die Gesetzgebungsprozesse zu beschleunigen, die Zustimmungsbedürftigkeit der Gesetze neu geregelt, so dass nun nur noch etwa 40 Prozent der Gesetze seitens des Bundesrats zustimmungspflichtig sind statt bis dahin 60 Prozent. Erstmals wurden durch die Föderalismusreform auch Bund und Länder gemeinsam zur Haushaltsdisziplin verpflichtet. 7.11.2 Außenpolitik Auch in der Außenpolitik folgte die Regierung Merkel im Wesentlichen der Linie der Regierung Schröder, nicht zuletzt aufgrund personeller Kontinuität, denn Außenminister Steinmeier hatte bereits als Kanzleramtsminister der Jahre 1999 bis 2005 großen Einfluss auf die Gestaltung der deutschen Außenpolitik. Eine erkennbare Abweichung vom Kurs der Vorgängerregierung war lediglich für das Verhältnis zu den USA zu konstatieren, das Bundeskanzlerin Merkel wieder zu konsolidieren suchte, ohne jedoch etwa auf die Linie der USA in Bezug auf den Irak, den Iran oder Nordkorea einzuschwenken. Auf europäischer Ebene erwarb sich Merkel einigen Respekt, als sie auf dem EU-Gipfel im Dezember 2005, kurz nach ihrem Amtsantritt, in der festgefahrenen Auseinandersetzung um den so genannten Britenrabatt vermittelte und damit eine Einigung über die Finanzierung der EU in den Jahren 2007 bis 2013 ermöglichte; und während der deutschen Ratspräsidentschaft im ersten Halbjahr 2007 trieb sie den seit geraumer Zeit stagnierenden europäischen Verfassungsprozess voran, insbesondere während des EU-Gipfels im Juni, auf dem man sich endgültig von der gescheiterten Europäischen Verfassung verabschiedete, stattdessen auf den Entwurf eines ,,Reformvertrages" für die EU einigte, der allerdings wesentliche Punkte aus der Europäischen Verfassung übernahm. Auch auf dem G8-Gipfel in Heiligendamm (Mecklenburg-Vorpommern) im Juni 2007 präsentierte sich Merkel, die in diesem Jahr der Organisation präsidierte, als moderierende Kraft und brachte Einigungen in Bezug auf Hilfeleistungen für Afrika und den Klimaschutz, die allerdings nur unwesentlich über bereits bestehende Vereinbarungen auf niedrigem Niveau hinausgingen. Begleitet war das Gipfeltreffen von umfangreichen Protesten und Demonstrationen von Globalisierungsgegnern, denen die Staatsmacht mit zum Teil umstrittenen Sicherheitsmaßnahmen begegnete. Angesichts der zahlreichen Krisen und Konflikte weltweit und zur Bekämpfung des internationalen Terrorismus weitete sich das Auslandsengagement der Bundeswehr noch einmal aus. Zu den bereits laufenden Einsätzen wie etwa im Kosovo, in Bosnien und Herzegowina und in Afghanistan kam im Sommer 2006 im Rahmen einer EU-Mission ein gut halbjähriger Einsatz in der Demokratischen Republik Kongo zur Absicherung der dortigen Wahlen; und ab September 2006 beteiligte sich die Bundeswehr an der nach dem Libanonkrieg erweiterten Friedensmission im Libanon und war dort vorwiegend zur Kontrolle der Küsten auf See eingesetzt. In Afghanistan erweiterte die Bundesregierung im März 2007 das Engagement der Bundeswehr, indem sie auf Bitten der NATO einige Tornado-Kampfflugzeuge entsandte, die - weit über das bisherige Einsatzgebiet der Bundeswehr hinausgehend - über ganz Afghanistan die Luftaufklärung übernehmen und damit militärische Operationen der internationalen AfghanistanTruppen vorbereiten sollen. Zwar war dieser Einsatz nicht unmittelbar ein Kampfeinsatz, diente aber zur Vorbereitung von Militäraktionen und war deshalb sehr umstritten. Deutsche Mittelgebirge und Höhenzüge Gebirge Höchster Berg Wiehengebirge Heidbrink 320 m Höhe Elm Eilumer Horn 323 m Wesergebirge Hohenstein 340 m Bückeberg Bückeberg 367 m Deister Bröhn 405 m Süntel Hohe Egge 437 m Ith Lauensteiner Kopf 439 m Burgwald Knebelsrod 443 m Teutoburger Wald Barnacken 446 m Vogler Ebersnacken 460 m Siebengebirge Großer Ölberg 460 m Eggegebirge Preußischer Vermerstot 468 m Reinhardswald Gahrenberg 472 m Kyffhäuser Kulpenberg 473 m Leinebergland Bloße Zelle 480 m Steigerwald Scheinberg 499 m Bergisches Land Homert 519 m Solling Große Blöße 528 m Langenberge Schwengeberg 557 m Kaiserstuhl Totenkopf 557 m Spessart Geiersberg 586 m Habichtswald Hohes Gras 615 m Odenwald Katzenbuckel 626 m Fränkische Schweiz Kleiner Kulm 626 m Knüllgebirge Eisenberg 636 m Kaufunger Wald Hirschberg 643 m Westerwald Fuchskaute 656 m Ebbegebirge Nordhelle 663 m Pfälzer Wald Kalmit 673 m Kellerwald Wüstegarten 675 m Nordpfälzer Bergland Donnersberg 687 m Fränkische Alb Hesselberg 689 m Elbsandsteingebirge (deutscher Teil) Großer Zschirnstein 560 m Elbsandsteingebirge Decínský Sne?ník (Hoher Schneeberg) 721 m Eifel Hohe Acht 747 m Hoher Meißner Kasseler Kuppe 754 m Vogelsberg Taufstein 773 m Zittauer Gebirge Lausche 793 m Frankenwald Döbraberg 795 m Hunsrück Erbeskopf 818 m Elstergebirge (deutscher Teil) Hoher Brand 803 m Elstergebirge Pocatecky Vrch 818 m Linzgau Höchsten 833 m Rothaargebirge Langenberg 843 m Thüringer Schiefergebirge Großer Farmdenkopf 869 m Taunus Großer Feldberg 879 m Rhön Wasserkuppe 950 m Thüringer Wald Großer Beerberg Schwäbische Alb Lemberg Oberpfälzer Wald (deutscher Teil) Entenbühl Oberpfälzer Wald Cerchov (Schwarzkopf: Tschechische Republik) 1 042 m Fichtelgebirge Schneeberg 1 051 m Harz Brocken 1 142 m 982 m 1 015 m 901 m Erzgebirge (deutscher Fichtelberg Teil) 1 214 m Erzgebirge Klínovec (Keilberg, Tschechische Republik) 1 244 m Bayerischer Wald Großer Arber 1 456 m Schwarzwald Feldberg 1 493 m Microsoft ® Encarta ® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.