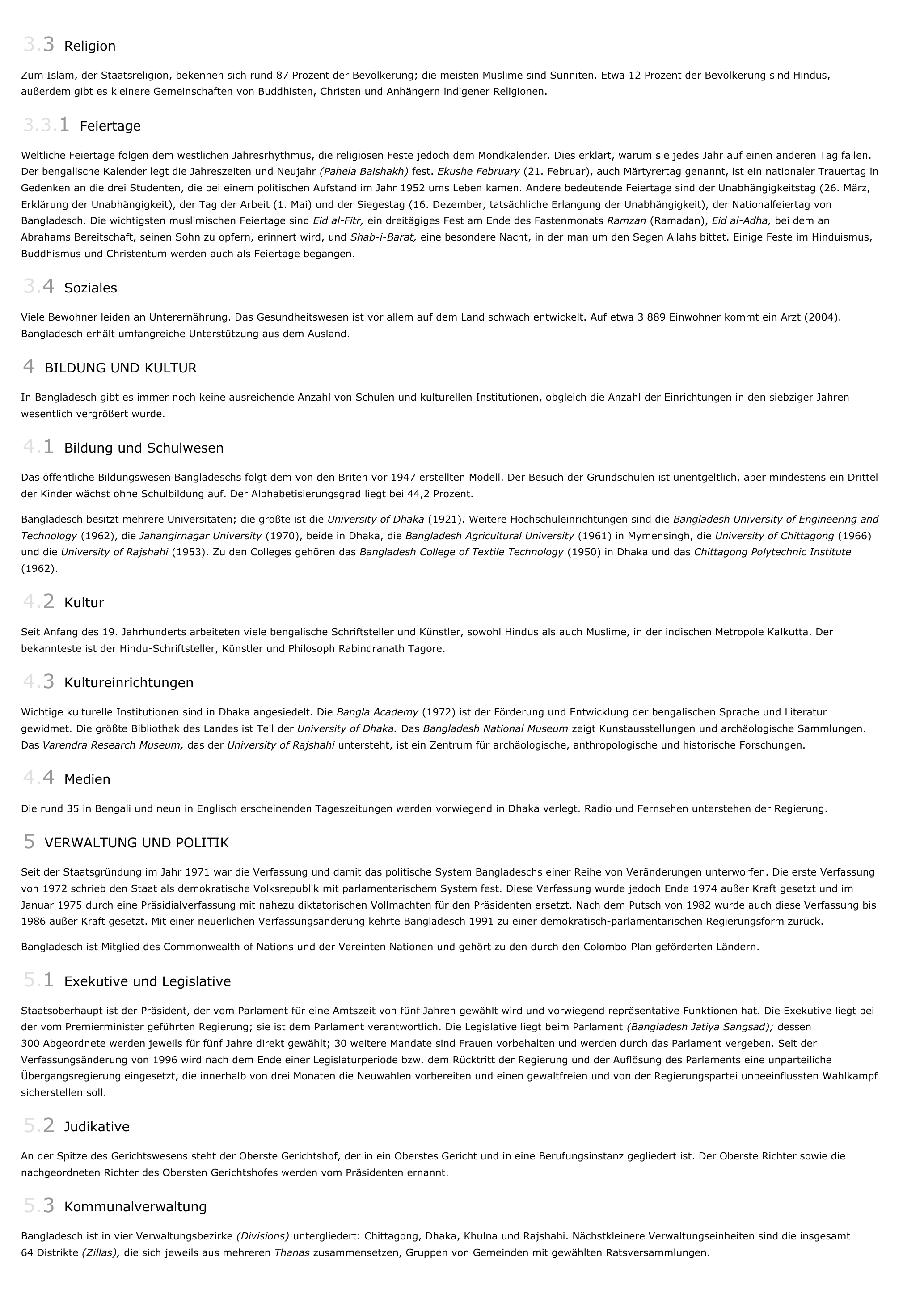Bangladesch - geographie. 1 EINLEITUNG Bangladesch, amtlich Volksrepublik Bangladesch; Republik in Südasien. Das Staatsgebiet grenzt im Westen, Norden und Osten an Indien, im Südosten an Myanmar und im Süden an den Golf von Bengalen, einen Meeresarm des Indischen Ozeans. Die Gesamtfläche des Landes beträgt 147 570 Quadratkilometer. Dhaka ist die Hauptstadt von Bangladesch und zugleich die größte Stadt des Landes. Von 1947 bis 1971 war Bangladesch eine Provinz von Pakistan. 1955 wurde der offizielle Name von Ostbengalen in Ostpakistan geändert. Am 26. März 1971 wurde die Unabhängige Republik Bangladesch ausgerufen. 2 LAND Bangladesch liegt im ostbengalischen Tiefland. Die Küste am Golf von Bengalen hat eine Länge von rund 580 Kilometern. 2.1 Physische Geographie Das Staatsgebiet wird von zahlreichen Flüssen durchzogen. Der Großteil des Landes wird von der breiten Schwemmlandebene im Bereich des Mündungsdeltas der Ströme Ganges und Brahmaputra und ihrer zahlreichen Nebenflüsse eingenommen. Diese fruchtbare Ebene wird während der Regenzeit alljährlich überflutet, weshalb sich ihre Fläche ständig verändert. Im Küstenbereich erstrecken sich die als Sundarbans bezeichneten Sumpfgebiete. Bergland mit größeren Erhebungen ist nur im äußersten Osten (Sylhet-Berge) und Südosten (Chittagong-Berge) des Landes verbreitet, insgesamt auf weniger als 10 Prozent der Staatsfläche. An der Grenze zu Myanmar liegt der Mowdok Mual, mit 1 003 Metern der höchste Punkt von Bangladesch. Im Bereich der Ost- und Nordgrenze zu Indien ist stellenweise Hügelland entwickelt. Die erodierten Überreste zweier alter Flussterrassen, der Madhupur Tract im nördlichen und zentralen Teil des Landes und der Barind zu beiden Seiten der nordwestlichen Grenze zu Indien, erreichen eine Höhe von etwa 30 Metern. 2.2 Flüsse und Seen Das Staatsgebiet wird von zahlreichen Flüssen durchzogen; sie bestimmen das Landschaftsbild von Bangladesch. Bei einigen Flüssen haben Ober-, Mittel- und Unterlauf unterschiedliche Namen. Während der sommerlichen Hauptregenzeit bei Vorherrschen des Südwestmonsuns können sich die Mündungsdeltas einzelner Flüsse vereinigen. Das gemeinsame Delta der beiden Hauptflüsse Ganges und Brahmaputra hat eine Fläche von 44 000 Quadratkilometern und zählt damit zu den ausgedehntesten Flussdeltas der Welt. 2.3 Klima Bangladesch wird von tropischem Monsunklima geprägt. Rund 80 Prozent des Jahresniederschlages fallen während des regenbringenden Sommermonsuns, der von Mai bis Mitte Oktober vorherrscht. In dieser Zeit kommt es regelmäßig zu Überschwemmungen, bei denen - wie z. B. 2004 - bis zu zwei Drittel des Landes unter Wasser gesetzt werden. Der mittlere Jahresniederschlag liegt landesweit um 1 500 Millimeter, im Nordosten können in regenreichen Jahren 5 000 Millimeter erreicht werden. Die Niederschläge werden im April/Mai und Oktober/November vereinzelt von tropischen Wirbelstürmen begleitet, die schwere Schäden anrichten können. Der Wirbelsturm vom November 1970, der mehr als 500 000 Menschenleben forderte, war eine der schlimmsten Naturkatastrophen des 20. Jahrhunderts. Ein weiterer Wirbelsturm im Bereich des Gangesdeltas forderte im April 1991 über 120 000 Menschenleben; Millionen wurden obdachlos. In Bangladesch sind die Temperaturen ganzjährig hoch. Der Januar ist der kühlste, der Mai der wärmste Monat. In Dhaka liegt die durchschnittliche Temperatur im Januar bei 19 °C, im Mai bei 29 °C. 2.4 Flora und Fauna Der weitaus größte Teil des Landes wird von landwirtschaftlichen Nutzflächen eingenommen, bewaldete Gebiete bedecken weniger als ein Sechstel der Landesfläche. In den Chittagong-Bergen gedeiht immergrüner tropischer Bergwald, in den trockeneren Ebenen Wälder mit laubwerfenden Bäumen wie Akazien und Banyanbäumen, und im südwestlichen Teil des Landes (Sundarbans) gibt es eines der weltweit größten Mangrovenwaldgebiete mit der endemischen Baumart Sundari. Bangladesch hat eine artenreiche Tierwelt mit 109 einheimischen Säugetierarten, 295 Vogelarten, 119 Reptilienarten, 19 Amphibienarten und rund 200 Arten von Meeresfischen und Süßwasserfischen. Bemerkenswerte Säugetiere sind Elefanten, Kragenbären, Lippenbären, Nebelparder, Bengalische Tiger, Leoparden, Rhesusaffen, Gibbons, Loris, Bantengs, Gaure, Gangesdelphine und Dugongs. Zur Vogelwelt gehören u. a. Eisvögel und die ihnen nahe verwandten Spinte, Bülbüls, Kuckucke, Drosslinge und Drongos (Sperlingsvögel), Adler (u. a. Kaiseradler, Schreiadler, Weißbauch-Seeadler), Geier, Hornvögel, Sichler, Blatthühnchen, Sittiche, Stare, Elstern, Nektarvögel und Rohrsänger. Die Reptilienfauna ist u. a. durch Krokodile, Schildkröten, Pythons und andere Schlangen (auch Giftschlangen) repräsentiert. 3 BEVÖLKERUNG Rund 95 Prozent der Bevölkerung Bangladeschs sind Bengalen; der überwiegende Teil von ihnen stammt von indoarischen Völkern ab. Zu den zahlenmäßig stärksten Minderheiten gehören Chakma und Mogh; sie sind mongolischer Herkunft und leben in den Chittagong-Bergen. Das Mundavolk der Santal und die Bihari, nichtbengalische Muslime, wanderten aus Indien ein. Bangladesch hat etwa 154 Millionen Einwohner (2008). Die Bevölkerungsdichte ist mit 1 147 Einwohnern pro Quadratkilometer eine der höchsten aller Staaten der Welt. Etwa 25 Prozent der Bevölkerung leben in Städten. Die Bevölkerung ist relativ gleichmäßig über das Land verteilt, mit Ausnahme der wenig besiedelten Chittagong-Berge und der nahezu unbewohnten Sundarbans. Die durchschnittliche Lebenserwartung liegt bei 63,2 Jahren (2008). 3.1 Wichtige Städte Zu den größten Städten Bangladeschs gehören die Hauptstadt Dhaka (5,38 Millionen Einwohner), Chittagong (1,36 Millionen Einwohner), Khulna (546 000 Einwohner), N?r ?yanganj (269 000 Einwohner) sowie die Stadt Rajshahi (325 000 Einwohner). 3.2 Sprache Bengali, die meistgesprochene indoarische Sprache, ist Amtssprache von Bangladesch. Sie hat eine eigene, von der Schrift des Sanskrit abgeleitete Schrift. Urdu wird von mehreren hunderttausend Menschen, von denen viele Ende der vierziger Jahre des 20. Jahrhunderts aus Indien einwanderten, gesprochen. Außerdem sind mehrere tibetobirmanische Sprachen verbreitet. 3.3 Religion Zum Islam, der Staatsreligion, bekennen sich rund 87 Prozent der Bevölkerung; die meisten Muslime sind Sunniten. Etwa 12 Prozent der Bevölkerung sind Hindus, außerdem gibt es kleinere Gemeinschaften von Buddhisten, Christen und Anhängern indigener Religionen. 3.3.1 Feiertage Weltliche Feiertage folgen dem westlichen Jahresrhythmus, die religiösen Feste jedoch dem Mondkalender. Dies erklärt, warum sie jedes Jahr auf einen anderen Tag fallen. Der bengalische Kalender legt die Jahreszeiten und Neujahr (Pahela Baishakh) fest. Ekushe February (21. Februar), auch Märtyrertag genannt, ist ein nationaler Trauertag in Gedenken an die drei Studenten, die bei einem politischen Aufstand im Jahr 1952 ums Leben kamen. Andere bedeutende Feiertage sind der Unabhängigkeitstag (26. März, Erklärung der Unabhängigkeit), der Tag der Arbeit (1. Mai) und der Siegestag (16. Dezember, tatsächliche Erlangung der Unabhängigkeit), der Nationalfeiertag von Bangladesch. Die wichtigsten muslimischen Feiertage sind Eid al-Fitr, ein dreitägiges Fest am Ende des Fastenmonats Ramzan (Ramadan), Eid al-Adha, bei dem an Abrahams Bereitschaft, seinen Sohn zu opfern, erinnert wird, und Shab-i-Barat, eine besondere Nacht, in der man um den Segen Allahs bittet. Einige Feste im Hinduismus, Buddhismus und Christentum werden auch als Feiertage begangen. 3.4 Soziales Viele Bewohner leiden an Unterernährung. Das Gesundheitswesen ist vor allem auf dem Land schwach entwickelt. Auf etwa 3 889 Einwohner kommt ein Arzt (2004). Bangladesch erhält umfangreiche Unterstützung aus dem Ausland. 4 BILDUNG UND KULTUR In Bangladesch gibt es immer noch keine ausreichende Anzahl von Schulen und kulturellen Institutionen, obgleich die Anzahl der Einrichtungen in den siebziger Jahren wesentlich vergrößert wurde. 4.1 Bildung und Schulwesen Das öffentliche Bildungswesen Bangladeschs folgt dem von den Briten vor 1947 erstellten Modell. Der Besuch der Grundschulen ist unentgeltlich, aber mindestens ein Drittel der Kinder wächst ohne Schulbildung auf. Der Alphabetisierungsgrad liegt bei 44,2 Prozent. Bangladesch besitzt mehrere Universitäten; die größte ist die University of Dhaka (1921). Weitere Hochschuleinrichtungen sind die Bangladesh University of Engineering and Technology (1962), die Jahangirnagar University (1970), beide in Dhaka, die Bangladesh Agricultural University (1961) in Mymensingh, die University of Chittagong (1966) und die University of Rajshahi (1953). Zu den Colleges gehören das Bangladesh College of Textile Technology (1950) in Dhaka und das Chittagong Polytechnic Institute (1962). 4.2 Kultur Seit Anfang des 19. Jahrhunderts arbeiteten viele bengalische Schriftsteller und Künstler, sowohl Hindus als auch Muslime, in der indischen Metropole Kalkutta. Der bekannteste ist der Hindu-Schriftsteller, Künstler und Philosoph Rabindranath Tagore. 4.3 Kultureinrichtungen Wichtige kulturelle Institutionen sind in Dhaka angesiedelt. Die Bangla Academy (1972) ist der Förderung und Entwicklung der bengalischen Sprache und Literatur gewidmet. Die größte Bibliothek des Landes ist Teil der University of Dhaka. Das Bangladesh National Museum zeigt Kunstausstellungen und archäologische Sammlungen. Das Varendra Research Museum, das der University of Rajshahi untersteht, ist ein Zentrum für archäologische, anthropologische und historische Forschungen. 4.4 Medien Die rund 35 in Bengali und neun in Englisch erscheinenden Tageszeitungen werden vorwiegend in Dhaka verlegt. Radio und Fernsehen unterstehen der Regierung. 5 VERWALTUNG UND POLITIK Seit der Staatsgründung im Jahr 1971 war die Verfassung und damit das politische System Bangladeschs einer Reihe von Veränderungen unterworfen. Die erste Verfassung von 1972 schrieb den Staat als demokratische Volksrepublik mit parlamentarischem System fest. Diese Verfassung wurde jedoch Ende 1974 außer Kraft gesetzt und im Januar 1975 durch eine Präsidialverfassung mit nahezu diktatorischen Vollmachten für den Präsidenten ersetzt. Nach dem Putsch von 1982 wurde auch diese Verfassung bis 1986 außer Kraft gesetzt. Mit einer neuerlichen Verfassungsänderung kehrte Bangladesch 1991 zu einer demokratisch-parlamentarischen Regierungsform zurück. Bangladesch ist Mitglied des Commonwealth of Nations und der Vereinten Nationen und gehört zu den durch den Colombo-Plan geförderten Ländern. 5.1 Exekutive und Legislative Staatsoberhaupt ist der Präsident, der vom Parlament für eine Amtszeit von fünf Jahren gewählt wird und vorwiegend repräsentative Funktionen hat. Die Exekutive liegt bei der vom Premierminister geführten Regierung; sie ist dem Parlament verantwortlich. Die Legislative liegt beim Parlament (Bangladesh Jatiya Sangsad); dessen 300 Abgeordnete werden jeweils für fünf Jahre direkt gewählt; 30 weitere Mandate sind Frauen vorbehalten und werden durch das Parlament vergeben. Seit der Verfassungsänderung von 1996 wird nach dem Ende einer Legislaturperiode bzw. dem Rücktritt der Regierung und der Auflösung des Parlaments eine unparteiliche Übergangsregierung eingesetzt, die innerhalb von drei Monaten die Neuwahlen vorbereiten und einen gewaltfreien und von der Regierungspartei unbeeinflussten Wahlkampf sicherstellen soll. 5.2 Judikative An der Spitze des Gerichtswesens steht der Oberste Gerichtshof, der in ein Oberstes Gericht und in eine Berufungsinstanz gegliedert ist. Der Oberste Richter sowie die nachgeordneten Richter des Obersten Gerichtshofes werden vom Präsidenten ernannt. 5.3 Kommunalverwaltung Bangladesch ist in vier Verwaltungsbezirke (Divisions) untergliedert: Chittagong, Dhaka, Khulna und Rajshahi. Nächstkleinere Verwaltungseinheiten sind die insgesamt 64 Distrikte (Zillas), die sich jeweils aus mehreren Thanas zusammensetzen, Gruppen von Gemeinden mit gewählten Ratsversammlungen. 5.4 Politische Parteien Zu den größten politischen Gruppierungen gehören die Awami-Liga (AL), die Bangladesh National Party (BNP), die Jatiya Party (JP) und die Partei Jamaat-e-Islami. 5.5 Verteidigung Der Wehrdienst ist in Bangladesch freiwillig. Das Land verfügt über ein Heer von 110 000, eine Marine von 9 000 und eine Luftwaffe von 6 500 Soldaten (2004). 6 WIRTSCHAFT Zuerst als Teil Britisch-Indiens, dann Pakistans, wurde die wirtschaftliche Entwicklung des heutigen Bangladesch lange vernachlässigt. Das Land lieferte große Mengen an Agrarprodukten einschließlich der weltweit größten Erntemenge an Jute, erhielt aber kaum Investitionen für den Ausbau der Verkehrsverbindungen und den Bau von Industriebetrieben. Die Handelsbilanz ist stark defizitär. Von den Erwerbstätigen arbeiten 52 Prozent in der Landwirtschaft, 14 Prozent in der Industrie und 35 Prozent im Dienstleistungsgewerbe. Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung gehören zu den größten Problemen des Landes. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) beträgt 61 897 Millionen US-Dollar (2006); dies entspricht einem BIP pro Einwohner von 396,80 US-Dollar. 6.1 Landwirtschaft 19,6 Prozent des Bruttoinlandsprodukts kommen aus der Landwirtschaft (2006). Es handelt sich zumeist um Kleinbauern, die nur geringe Erträge erwirtschaften. Reis, der zwei- bis dreimal im Jahr geerntet wird, ist das Hauptanbauprodukt in allen Landesteilen und wird auf fünf Sechstel der landwirtschaftlich nutzbaren Fläche angebaut. Hülsenfrüchte sind nach Reis die wichtigsten Anbaufrüchte. Daneben werden noch Ölfrüchte, Weizen, Kartoffeln, Bataten (Süßkartoffeln), Zuckerrohr, Bananen, Mangos und Ananas angebaut. Die wichtigste Exportkultur ist Jute. Sie wird in den überfluteten Gebieten des Ganges-Brahmaputradeltas angebaut. Tee wird fast ausschließlich im Nordosten, in der Gegend von Sylhet, gepflanzt. Es gibt zahlreiche Rinder und Büffel, die jedoch nicht als Schlachtvieh gezüchtet werden. 6.2 Forstwirtschaft und Fischerei Die für den Handel bedeutenden Holzarten sind Sundari, Gewa und Teak. Bambus ist ebenfalls ein wichtiges Produkt der Forstwirtschaft. Die Fischgattung Hilsa und Garnelen sind für die Fischerei von Bedeutung. Die Fangmenge besteht vorwiegend aus Süßwasserfischen. 6.3 Bergbau In Bangladesch gibt es nur wenige Bodenschätze. Erdgas, die wichtigste Energiequelle, kommt an einigen Stellen im Nordosten des Landes vor. Im Nordwesten gibt es Kohlevorkommen, im Deltagebiet große Torflagerstätten. Im Nordosten findet man Kalkstein und Tonerde. 6.4 Industrie Die verarbeitende Industrie trägt nur knapp ein Zehntel zum Bruttosozialprodukt Bangladeschs bei. Sie setzt sich vorwiegend aus nicht mechanisierten Kleinbetrieben zusammen, die insgesamt über drei Millionen Erwerbstätige beschäftigen. Die Hauptprodukte des Landes sind Juteerzeugnisse (Tauwerk und Säcke), Textilien, Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren sowie Holz-, Zuckerrohr- und Bambuserzeugnisse. Großbetriebe verarbeiten Jute und Zuckerrohr. Der Großteil der Schwerindustrie des Landes ist in der Hafenstadt Chittagong angesiedelt. 6.5 Währung und Bankwesen Währungseinheit ist der Taka zu 100 Paisa. Die staatlich geführte Bangladesch Bank ist die Zentralbank des Landes. 6.6 Binnen- und Außenhandel Die Hats, die einheimischen Märkte, stellen das Kernstück des Binnenhandels dar. Das Binnen- und Außenhandelsvolumen Bangladeschs ist gering. Die Hauptexportgüter sind Juteprodukte und Rohjute; weitere Ausfuhrwaren sind Bekleidung, Meeresfrüchte, Tee und Lederwaren. Importiert werden Nahrungsmittel, Grundstoffe, Brennstoffe, Maschinen und Transportausrüstungen. Die Exporte gehen in erster Linie in die Vereinigten Staaten, nach Italien, Großbritannien, Japan, Deutschland, Belgien und Singapur. Die Importe kommen vorwiegend aus den Vereinigten Staaten, Hongkong, Japan, Großbritannien, Singapur, Indien und Frankreich. 6.7 Verkehrswesen Das Land verfügt über rund 239 200 Kilometer Straßen (2004). Das Schienennetz des Landes hat eine Länge von etwa 2 900 Kilometern (2005). Der Bau der Verkehrswege gestaltet sich schwierig, und Überschwemmungen zerstören oft das gesamte Verkehrsnetz. Der Großteil des inländischen Fracht- und Passagierverkehrs wird über Wasserstraßen abgewickelt. Die schiffbaren Wasserwege haben während der Regenzeit eine Länge von mindestens 8 050 Kilometern (4 025 Kilometer in der Trockenzeit). Der internationale Frachtverkehr wird in den Hafenstädten Chittagong und Chalna abgefertigt. Die staatliche Luftfahrtgesellschaft Bangladesh Airlines (Biman) versieht einen nationalen und internationalen Flugdienst. Der internationale Flughafen befindet sich in Dhaka. 6.8 Energie 93,7 Prozent der Energie werden in Wärmekraftwerken erzeugt, die entweder mit Kohle, Erdgas oder Erdölprodukten betrieben werden; 6,3 Prozent werden in Wasserkraftwerken erzeugt (2003). Der Energieverbrauch Bangladeschs lag 2003 bei 16,2 Milliarden Kilowattstunden. 7 GESCHICHTE Zur Geschichte des heutigen Staates Bangladesch vor seiner Unabhängigkeit 1971 siehe auch die Abschnitte ,,Geschichte" in den Artikeln Indien und Pakistan. Im Zuge der Teilung Indiens 1947 war der mehrheitlich muslimisch bewohnte Teil Bengalens als Ostpakistan dem Staat Pakistan zugeschlagen worden. Die beiden pakistanischen Landesteile, West- und Ostpakistan, waren etwa 1 500 Kilometer voneinander entfernt; getrennt wurden sie durch indisches Staatsgebiet. Angesichts der politischen und wirtschaftlichen Dominanz Westpakistans innerhalb des Gesamtstaates bildete sich schon bald in Ostpakistan eine nach Unabhängigkeit strebende Bewegung, die vor allem von der Awami-Liga getragen wurde. Der zunehmende Wunsch nach Unabhängigkeit manifestierte sich deutlich in den Parlamentswahlen von 1970: Die Awami-Liga gewann fast alle der für Ostpakistan reservierten Sitze und damit die absolute Mehrheit im Parlament. Am 26. März 1971 proklamierte Mujibur Rahman, der Vorsitzende der Awami-Liga, die Unabhängige Republik Bangladesch. Die pakistanische Zentralregierung suchte mit militärischen Mitteln die Unabhängigkeit Ostpakistans zu verhindern; aber mit der politischen und vor allem militärischen Hilfe Indiens, das nach einem kurzen Krieg Pakistan zur Kapitulation veranlasste, gelang es Ostpakistan um die Jahreswende 1971/72, seine Unabhängigkeit durchzusetzen. Im Januar 1972 konstituierte sich die erste Regierung des nun unabhängigen Bangladesch mit Mujibur Rahman als Premierminister. Schon bald erkannten die meisten anderen Länder der Welt Bangladesch als souveränen Staat an; Pakistan allerdings verweigerte ihm bis 1974 die Anerkennung. 1974 wurde Bangladesch in die Vereinten Nationen aufgenommen. Vordringlichste Aufgabe der Regierung Rahman war der wirtschaftliche Wiederaufbau des vom Krieg mit (West-)Pakistan schwer in Mitleidenschaft gezogenen Landes, die Errichtung eines stabilen politischen Systems sowie die Wiedereingliederung der Millionen, während des Krieges nach Indien geflüchteten und nun zurückkehrenden Bengalen. Rahman verstaatlichte weite Bereiche der Wirtschaft (u. a. Industrie und Banken) und führte ein planwirtschaftliches System ein; aber trotz zusätzlicher umfangreicher Hilfeleistungen aus dem Ausland hatten Rahmans Wirtschaftsreformen wenig Erfolg. Im November 1972 gab sich Bangladesch eine Verfassung, die das Land als Volksrepublik mit parlamentarischem System definierte. 1974 wurde das Land von einer Hochwasserkatastrophe heimgesucht, die den Großteil der Reisernte zerstörte und eine schwere Hungersnot nach sich zog. Vor diesem Hintergrund verschärften sich die innenpolitischen Spannungen und Machtkämpfe rapide. Um einen drohenden Bürgerkrieg abzuwenden, rief Mujibur Rahman Ende 1974 den Ausnahmezustand aus und wandelte im Januar 1975 per Verfassungsänderung die parlamentarische Republik in ein Präsidialregime um. Das Amt des nun mit nahezu diktatorischen Vollmachten ausgestatteten Staatspräsidenten übernahm er selbst. Aber auch mit erheblich erweiterten Machtbefugnissen gelang es ihm nicht, die Lage zu beruhigen; im August 1975 wurde er durch einen blutigen Militärputsch gestürzt und ermordet. Nach einem weiteren Putsch gegen den neuen Präsidenten, Khandakar Mushtaque Ahmed, setzte sich im November 1975 ein ,,Regierungsausschuss" an die Spitze des Staates. In diesem Ausschuss stieg rasch General Zia ul-Rahman zur führenden Persönlichkeit auf: 1976 wurde er Oberster Kriegsrechtsadministrator (das Land stand seit dem Putsch gegen Mujibur Rahman unter Kriegsrecht), 1977 übernahm er das Amt des Staatspräsidenten, und 1978 wurde er von der Bevölkerung direkt mit großer Mehrheit als Staatspräsident bestätigt. Unter Zia ul-Rahman stabilisierte sich sowohl die innenpolitische wie die wirtschaftliche Lage und es kehrten schließlich wieder demokratischere und zivilere Verhältnisse ein. Aus den Parlamentswahlen von 1979 ging die neu gegründete, Zia ul-Rahman nahe stehende Bangladesh National Party (BNP) als absolut stärkste Partei hervor, so dass sich die Regierung ul-Rahman auf eine breite parlamentarische Mehrheit stützen konnte. Im Mai 1981 wurde Zia ul-Rahman bei einem letztlich fehlgeschlagenen Putsch ermordet. Sein Nachfolger im Präsidentenamt wurde der bisherige Vizepräsident Abd asSattar; er wurde im November 1981 durch allgemeine Wahlen im Amt bestätigt. Im März 1982 wurde auch Abd as-Sattar durch einen Militärputsch gestürzt; die Macht übernahm General Hussein Mohammed Ershad, zunächst als Oberster Kriegsrechtsadministrator, ab Dezember 1983 als Präsident. Ershad setzte die Verfassung außer Kraft, verbot vorübergehend alle politischen Parteien und verhängte erneut das (1979 aufgehobene) Kriegsrecht. Bei den Parlamentswahlen im Mai 1986 gewann die dem Präsidenten nahe stehende Jatiya Party (JP) knapp die absolute Mehrheit der Mandate. Anfänglich boykottierten Teile der Opposition das Parlament, da Ershad sich weigerte, das Kriegsrecht aufzuheben; und auch an den Präsidentschaftswahlen im Oktober 1986, bei denen Ershad mit über 80 Prozent der Stimmen im Amt bestätigt wurde, nahm die Opposition nicht teil. Im November 1986 hob Ershad schließlich das Kriegsrecht auf und setzte die Verfassung wieder in Kraft. Im Juni 1988 wurde per Gesetz der Islam zur Staatsreligion erhoben. Bei schweren Flutkatastrophen 1988 und 1989 wurden etwa drei Viertel des Landes überschwemmt und über 30 Millionen Menschen obdachlos. Unterdessen verschärfte sich die Opposition gegen Ershads Regime, was sich in zahlreichen Protestaktionen äußerte. Angeführt wurde die Protestbewegung von den beiden größten Oppositionsparteien, der BNP unter Khaleda Zia, der Witwe Zia ul-Rahmans, und der Awami-Liga unter Sheikh Hasina Wajed, der Tochter von Mujibur Rahman. In Reaktion auf den zunehmenden Widerstand gegen sein Regime verhängte Ershad im November 1990 den Ausnahmezustand; zugleich legte er einen Zehnpunkteplan zur Beruhigung der gespannten innenpolitischen Situation vor, der jedoch von der Opposition abgelehnt wurde. Daraufhin löste er das Parlament auf, trat am 6. Dezember 1990 zurück und machte damit den Weg für Neuwahlen frei. Die Parlamentswahlen vom 27. Februar 1991 gewann überraschend die BNP: Sie erhielt 170 der 300 direkt vergebenen Mandate und wurde damit absolut stärkste Kraft. Am 20. März 1991 wurde die BNP-Vorsitzende Khaleda Zia als Premierministerin von Bangladesch vereidigt. Im April 1991 wurde Ershad wegen Korruption und Machtmissbrauchs angeklagt und wenig später zu einer 13-jährigen Haftstrafe verurteilt. Im September 1991 wurde eine Verfassungsänderung verabschiedet, durch die das Präsidialsystem wieder abgeschafft wurde und das Land zu einer demokratisch-parlamentarischen Regierungsform zurückkehrte, und im Oktober 1991 wurde auf der Grundlage dieser neuen Verfassung Abdur Rahman Biswas zum Staatspräsidenten (mit vorwiegend repräsentativen Funktionen) gewählt. Die folgenden Jahre wurden bestimmt durch die immer heftiger werdende Auseinandersetzung zwischen Regierung und Opposition, die zusätzlich Nahrung fand durch die wachsende persönliche Feindschaft zwischen der Regierungschefin Khaleda Zia und Hasina Wajed, der Vorsitzenden der größten Oppositionspartei, der Awami-Liga. Unter dem Vorwurf der Wahlfälschung, der Unfähigkeit und der Korruption und aus Widerstand gegen den zunehmenden Fundamentalismus forderte die Opposition immer lautstarker den Rücktritt der Premierministerin, organisierte Massendemonstrationen und zahlreiche Generalstreiks, die zeitweise praktisch ganz Bangladesch lahm legten. Der Konflikt zwischen Regierung und Opposition entlud sich immer häufiger auch in gewaltsamen Auseinandersetzungen mit zahlreichen Toten und Verletzten. Im Dezember 1994 legten die meisten Abgeordneten der Opposition ihre Parlamentsmandate nieder, nachdem sie schon seit dem Frühjahr die Parlamentssitzungen boykottiert hatten und im November ein internationaler Versuch, zwischen Regierung und Opposition zu vermitteln, gescheitert war. Angesichts der verfahrenen innenpolitischen Situation stimmte Khaleda Zia im November 1995 vorgezogenen Neuwahlen zu. Allerdings brachten diese Wahlen, die am 15. Februar 1996 stattfanden, keine Beruhigung der Lage, sondern führten im Gegenteil noch zu einer Verschärfung: Die Oppositionsparteien hatten zum Wahlboykott aufgerufen, die Wahlbeteiligung erreichte gerade einmal 15 Prozent, die BNP gewann fast alle Parlamentssitze. Unter dem Eindruck der anhaltenden Auseinandersetzungen verabschiedete das Parlament am 26. März 1996 eine Verfassungsänderung, der zufolge Parlamentswahlen künftig jeweils unter einer neutralen Übergangsregierung stattfinden sollten. Am 29. März trat Khaleda Zia zurück, und am 30. März löste Staatspräsident Biswas das Parlament auf und setzte eine Übergangsregierung ein. Aus den Neuwahlen am 12. Juni 1996 ging die oppositionelle Awami-Liga mit 147 Mandaten als deutlich stärkste Kraft hervor; die bisher regierende BNP kam auf nur noch 116 Mandate. Neue Premierministerin wurde die Awami-Vorsitzende Hasina Wajed; sie ging eine Koalition mit der Jatiya Party des noch immer inhaftierten Ershad ein und konnte sich somit auf eine bequeme Mehrheit im Parlament stützen. Im Oktober 1996 wurde Shahabuddin Ahmad zum neuen Staatspräsidenten gewählt. Oberstes außenpolitisches Ziel der Regierung Wajed war die Verbesserung der Beziehungen zum Nachbarstaat Indien, die seit dem Sturz der ersten Awami-Regierung 1975 erheblich gespannt waren. Bereits im Dezember 1996 schlossen Bangladesch und Indien ein erstes Abkommen, das den Zugang der beiden Länder zum Wasser des Ganges regelte; weitere Abkommen, etwa über den bilateralen Ausbau von Handel und Verkehr sowie den endgültigen Grenzverlauf zwischen beiden Ländern, folgten. Außerdem erbrachte die Wiederannäherung an Indien auch eine partielle Entspannung im Inneren: Die seit Gründung des Staates Bangladesch für ihre Unabhängigkeit kämpfenden und dabei von Indien unterstützten Aufständischen in den mehrheitlich buddhistisch bewohnten Chittagong-Bergen im Südosten des Landes verzichteten auf die Unabhängigkeit, stimmten dafür im März 1997 einem Abkommen mit der bangladeschischen Regierung zu, das der Bergregion weitreichende Autonomie zusicherte sowie die Rückkehr der etwa 50 000 aus der Chittagong-Region nach Indien Geflohenen in die Wege leitete. Durch die Rückkehr der Flüchtlinge sahen sich nun allerdings die während der siebziger Jahre etwa 300 000 in den Chittagong-Bergen angesiedelten Muslime in ihrer Existenz bedroht, was nicht nur hier zu neuen Unruhen führte, sondern auch landesweit massive Proteste der nun von Khaleda Zia angeführten Opposition hervorrief. Generell änderte sich unter der Regierung Wajed wenig an der innenpolitischen Situation; der Konflikt zwischen Regierung und Opposition ging unvermindert weiter, lediglich die Vorzeichen hatten sich geändert: Nun war es Khaleda Zia als Oppositionsführerin, die mit ihrer BNP sowie einer Reihe mehr oder weniger radikaler nationalistischer und muslimischer Parteien gegen die Premierministerin Hasina Wajed agierte, zahlreiche Massendemonstrationen und Generalstreiks organisierte und die Premierministerin zum Rücktritt aufforderte. Es war insbesondere der indienfreundliche sowie auf Demokratisierung und Modernisierung des Landes ausgerichtete säkulare Kurs der Regierung Wajed, der auf den heftigen Widerstand der Opposition stieß. Die Auseinandersetzungen forderten auch jetzt wieder zahlreiche Tote und Verletzte, zumal besonders auch die Gewaltbereitschaft radikaler islamischer Gruppen erkennbar zunahm; die politische Entwicklung des Landes stagnierte unterdessen, und das Wirtschaftswachstum beruhte in erster Linie auf der Tatsache, dass das Land während Wajeds Regierungszeit von Naturkatastrophen verschont blieb und Rekordernten einfahren konnte. Unbeirrt von den inneren Konflikten blieb Hasina Wajed bis zum Ende der Legislaturperiode im Amt; die Regierung Wajed war die erste Regierung in der Geschichte Bangladeschs, die regulär eine volle Legislaturperiode absolvieren konnte. Am 15. Juli 2001 trat Hasina Wajed verfassungsgemäß zurück und übergab die Amtsgeschäfte einer unparteilichen Übergangsregierung. Der nun folgende Wahlkampf war geprägt von der persönlichen Feindschaft zwischen Hasina Wajed und Khaleda Zia und überschattet von gewalttätigen Auseinandersetzungen, die insgesamt etwa 200 Tote forderten. Aus den Parlamentswahlen am 1. Oktober 2001 ging die BNP unter Khaleda Zia mit 185 Mandaten überraschend deutlich als absolut stärkste Kraft hervor, und zusammen mit ihrem Koalitionspartner, der islamistischen Partei Jamaat-e-Islami, verfügte sie über 201 Mandate und damit über die zu einer Verfassungsänderung notwendige Zweidrittelmehrheit im Parlament. Die Awami-Liga erreichte entgegen allen Voraussagen nur noch 62 Mandate. Eine Woche nach den Wahlen wurde Khaleda Zia erneut als Premierministerin vereidigt. Am 12. November 2001 wählte das Parlament den bisherigen Außenminister Badruddoza Chowdhury von der regierenden BNP zum neuen Staatspräsidenten, der jedoch schon im Juni 2002 wegen Unstimmigkeiten mit der Regierung wieder zurücktrat. Sein Nachfolger wurde der Universitätsprofessor Iajuddin Ahmed (ebenfalls BNP). An der Lage im Lande änderte sich unter der Regierung Zia nichts, lediglich die Vorzeichen hatten sich erneut geändert: Gewaltsame Auseinandersetzungen zwischen Anhängern der Regierung und der Opposition waren an der Tagesordnung, die Opposition organisierte wiederholt Generalstreiks, islamistische Anschläge mit zahlreichen Toten nahmen, dem weltweiten Trend folgend, auch in Bangladesch zu. Ihr Wahlversprechen, die Gewalt einzudämmen, konnte Zia nicht einlösen. Lediglich in der Wirtschaft konnte die Regierung dank eines auch von der Weltbank unterstützten Reformprogramms einige Erfolge vorweisen, die jedoch durch die instabile politische Situation gefährdet waren. Zum Ende ihrer Amtszeit trat Zia Ende Oktober 2006 zurück. Die Bildung der von der Verfassung vorgeschriebenen Übergangsregierung scheiterte jedoch, da sich BNP und Awami-Liga nicht auf einen Übergangspremierminister einigen konnten; am Ende übernahm Staatspräsident Ahmed interimistisch die Regierungsgeschäfte. Auch diese Phase war von blutigen Unruhen mit zahlreichen Toten begleitet. Microsoft ® Encarta ® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.